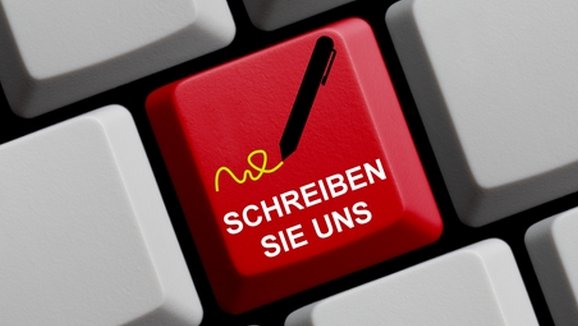Zur Diskussion um Windkraft im Raum Bad Wurzach, insbesondere zur Präsentation des Projekts Hummelluckenwald im Bad Wurzacher Gemeinderat am 24. April
Zur Gemeinderatssitzung im Kursaal mit Informationsveranstaltung zum Projekt Hummelluckenwald am 24. April zunächst eine allgemeine Vorbemerkung: Warum wurde bei der erwarteten Zahl von Besuchern nicht die hauseigene, leistungsfähige Lautsprecheranlage genutzt? So gerieten die langen Monologe der Planer streckenweise zu einem schwerverständlichen Lispeln. Die mit dem Beamer gezeigten schriftlichen Erläuterungen der Planer waren in so kleiner Schrift abgefasst, dass sie von den hinteren Reihen aus kaum lesbar waren. So löblich die Verlegung der Gemeinderatssitzung in den Kurhausaal war, damit möglichst viele Bürger an der Information teilhaben, so ärgerlich war die Umsetzung. Ziel einer Gemeinderatssitzung mit eingebundener Informationsveranstaltung sollte es sein, dass nicht nur die Mitglieder des Gemeinderates, sondern auch die Zuhörer alle Informationen vollinhaltlich erfassen können.
Nun zur inhaltliche Kritik: Wie üblich wurden den betroffenen Kommunen hohe Erlösanteile an der Stromproduktion versprochen. Auf einer der Folien stand, leicht zu übersehen, dass ab Inbetriebnahme der Anlagen auch gemeinnützige Vereine (Blasmusik, Theatergruppe, Förderverein usw.) mit Zuwendungen rechnen können. Man versucht, den Widerstand mit dem Scheckheft zu überwinden. Dabei wird ein „Nasenwasser“ offeriert; genannt wurden 82.000 € pro Jahr, wovon 90 Prozent auf die Gemeinde Bad Wurzach entfallen sollen. Eine lächerliche Summe angesichts der enormen Belastungen, die vor allem die Anwohner ertragen müssten, und angesichts der hohen Erlöse, die von den Betreibern erzielt würden.
Leider haben die Gemeinderäte nicht die Frage gestellt, ob diese Wohltaten ab Betriebsbeginn mit einer vertraglich festgesetzten Summe oder prozentual vom Gewinn abgeführt werden. In letzterem Falle kann es zehn Jahre und mehr dauern, bis der erste Cent fließt, da der „Gewinn“ über Abschreibungen, Steuern, Wartung und Reparaturkosten, allgemeine laufende Betriebskosten und Kapitaldienst usw. über Jahre durch buchmäßige Verluste heruntergerechnet wird.
Wenig aufschlussreich waren die technischen Erläuterungen. Der Sockel der Anlagen soll einen Durchmesser von 25 bis 30 Meter aufweisen. Wie tief reicht der Sockel in den Boden? Wie hoch ist die Gesamtmasse von Stahlarmierung und Beton? Bei ähnlichen Großanlagen sind das bis zu 5000 Tonnen. Gehen die Antragsteller eine vertragliche Verpflichtung zum – vollständigen – Rückbau der Sockel auf ihre Kosten nach wievielen Betriebsjahren ein? Ist bei den prognostizierten Kosten der Inflationsausgleich berücksichtigt? Bei zahlreichen Projekten sind diese Rücklagen deutlich zu gering bemessen gewesen.
Bei einem von einer Volksbank finanzierten Projekt musste ein frisch gebauter Sockel einer relativ kleinen Anlage aufgrund eines Gerichtsbeschlusses wieder entfernt werden. Da die Rücklagen für den nicht geplanten vorzeitigen Rückbau nicht ausreichten, musste jene Bank ca. 650.000 € aus eigenen Mitteln zuschießen.
Wie wird diese Rückbauverpflichtung seitens der Antragsteller über eine auch bei einer Insolvenz der Betreiber oder Investoren nicht angreifbaren Rücklage zugunsten der Grundstückseigentümer abgesichert?
Seit einigen Jahren gibt es Bestrebungen und zwischenzeitlich auch Urteile, den Begriff „Vollständiger Rückbau“ neu zu definieren. Demnach sollte es genügen, die oberirdischen Teile des Sockels vollständig zu entfernen und die unter dem obersten Bodenhorizont befindlichen Teile nur bis zu einer Tiefe von 60 Zentimetern bis 1 Meter abzutragen. Das entstehende Loch wird anschließend mit Boden aus der Umgebung aufgefüllt.
Aus verständlichen Gründen werden Betreiber und Investoren versuchen, den teuren Rückbau zu vermeiden. Durch „Repowering“, das heißt Nutzung des bestehenden Sockels für eine Ersatzanlage, ließe sich das Problem in die Zukunft verschieben. Die Nachfolge-Generation der Anwohner hätte dann die Nachbarschaft der monströsen Türme für weitere Jahrzehnte zu tragen.
Nicht nur die Betonsockel, auch die riesigen Rotorblätter, heute häufig aus asiatischer Fertigung, verursachen bei Ersatz oder Entsorgung Probleme. Der zur Gewichtsreduzierung gerne verwendete Kern aus Balsaholz wird bei vielen Rotorblättern mit Faser-Verbundkunststoffen umhüllt. Um den teuren und schwierigen Abtransport der heute bis zu 80 Meter langen Rotorblätter zu vermeiden, wäre es naheliegend, die Rotorblätter vor Ort in „handlichere“ Teile zu zerlegen. Davor wird wegen der bei der Zerlegung auftretenden krebserzeugenden Faserpartikel dringend gewarnt. Diese können selbst bei einer Nasszerlegung die Umgebung nachhaltig kontaminieren.
Es gehört deshalb zur Fürsorgepflicht einer Kommune, die Zerlegung von Rotorblättern vor Ort bußgeldbewehrt vertraglich auszuschließen.
Werden die Anlagen nach Inbetriebnahme an fremde, gegebenenfalls auch ausländische Investoren verkauft? Besitzt die Gemeinde ein Mitspracherecht bei einem Verkauf? Wie ist abgesichert, dass bei einem Verkauf alle Lasten auf den Käufer übergehen? Ist die vollständige Gefährdungshaftung über die gesamte Betriebsdauer gesichert? Bei einer Insolvenz des Betreibers würden vermutlich die Zahlungen an die Versicherungen eingestellt werden, es sei denn, die Versicherungsbeiträge werden zu Lasten der Kommune weiter abgeführt.
Wie groß sind die Eingriffe für die für den Schwertransport notwendige Erweiterung des Wegenetzes? Welche Montagefläche für den Kran wird benötigt? Man unterliege bei dieser Frage nicht gutgläubig Versprechungen der Antragsteller einer baldigen Renaturierung, da diese Flächen für den Reparaturfall bleiben müssen.
Wann und wie erfolgt der Anschluss ans Stromnetz? Wo werden diese Trassen verlegt? Eine Antwort auf einige dieser Fragen könnten die Gemeinderäte bei einer Besichtigung der Anlagen bei Bad Saulgau finden.
Inwieweit können Trinkwasservorkommen gefährdet sein? Anlagen dieser Größe besitzen Vorräte von ca. 1000 l an Schmier- und Kühlstoffen sowie Löschgasen, die sich entweder im Fuß der Anlage oder oben im Maschinenhaus befinden (telefonische Auskunft Fa. Enercon). Die bisher eingesetzten Stoffe gelten bei Austritt als höchst klimagefährdend, so wird das für den Brandschutz häufig eingesetzte Schwefelhexafluorid (SF6) 22.200 mal so klimagefährdend als CO2 eingestuft. Meist sind diese Stoffe zwar chemisch inert (kaum reaktionsfähig), können über Zersetzungsprodukte Mensch und Tier dennoch Schaden zufügen und das Grundwasser ungenießbar machen. Ersatzstoffe wie Ammoniak oder CO2 sind ebenfalls nicht unproblematisch. Ammoniak wirkt aggressiv und ätzend, bei CO2 und Ammoniak tritt zudem das Druckproblem auf. Wer meint, die Wartung von Windkraftanlagen sei eine unproblematische Kleinigkeit, dem sei das Studium der im Internet abrufbaren Ausführungen über Kühl- und Schmierstoffe in Windkraftanlagen empfohlen.
Sind die in den Boden versenkten Beton- und Stahlmassen wirklich trinkwasserneutral? Gilt das auch für die häufig verwendeten Stabilisierungszusätze für Beton? Beton ist säureempfindlich. Fichtenwaldböden reagieren bei uns zumindest in den oberen Horizonten sauer. Reaktionen zwischen Huminsäuren und Beton sind deshalb möglich.
Wer sich schon öfters einen Wind-„Park“ von der Nähe angesehen hat, dem könnten auch ölverschmierte Maschinenhäuser aufgefallen sein. Solche, laut Herstellern und Betreibern angeblich äußerst unwahrscheinlichen Störungen treten eben häufiger auf, als von diesen eingeräumt wird.
Ca. 10.200 Haushalte könnten – laut Prospekt – von den Humberger Anlagen mit Strom versorgt werden. Wirklich versorgt in der kalten, windarmen Winternacht? Hier wurde wieder die alte Behauptung bedient, die rein rechnerische Lieferung von Strom sei gleichzusetzen mit dem Begriff „Versorgung“.
Die spezielle Umweltproblematik für unseren Raum fand weder bei Gemeinderäten noch bei den Antragstellern Erwähnung. Kein Wort davon, dass das Planungsgebiet Teil des Wurzacher Beckens ist und deshalb besonderen Schutz genießt. Auch hatte es anscheinend kein Gemeinderat für notwendig gefunden, den fundierten und vermutlich als letzte Warnung zu verstehenden Beitrag von Ulrich Grösser in der Bildschirmzeitung über geplante Windkraftanlagen in der Einflugschneise der Zugvögel zum Naturschutzgebiet Rohrsee in die Diskussion einzubringen. Die Kurzfassung seines Artikels könnte lauten: „Vogelmord in Sichtweite eines europäischen Vogelschutzgebietes“. Vielleicht werden die Pläne für die Hummellucken aber auch zu Plänen von „nationaler Bedeutung“ erhoben. Damit lässt sich heute nahezu alles rechtfertigen, was früher streng verboten war.
Durchaus nachvollziehbar der Einwand von Ortsvorsteher Leupolz, der sich in seinem Wirkungsbereich Eintürnen/Eintürnenberg gleich von zwei Seiten, nämlich vom geplanten Windpark von Alttann und vom geplanten Windpark Hummellucken beeinträchtigt sieht. Warum meinte er hinzusetzen zu müssen, dass er eigentlich schon „für“ die Windkraft sei? Das klang fast so, als müsse er sich als regierungstreuer Staatsbürger dafür entschuldigen, diese Projekte von angeblich „nationale Bedeutung“ kritisch zu sehen.
Bereits in einem anderen Zusammenhang hat unsere Bürgermeisterin erklärt, die Gemeinde besäße bei Windkraftprojekten nur ein Anhörungsrecht, aber kein Entscheidungsrecht. Das sahen bei einem Windkraftprojekt in Aichstetten der damalige Bürgermeister und sein Vertreter ebenso. Gegen den ausdrücklichen Widerstand dieser Herren gelang es, den Gemeinderat von Aichstetten von der Notwendigkeit zu überzeugen, einen renommierten Fachanwalt einzuschalten. Dieser Fachanwalt aus Dießen am Ammersee wurde daraufhin gegen den Widerstand des Bürgermeisters beauftragt. Die Windkraftanlagen wurden nicht gebaut. Der Anwalt aus Dießen nimmt Vertretungen vor dem Europäischen Gerichtshof (EUGH) sowie vor dem Bundesverfassungsgericht wahr.
Die Veranstaltung vom 24. April ließ viele Fragen offen. Werden auf diese keine überzeugenden Antworten gefunden, wird unser Gemeinwesen schweren Schaden nehmen.
Hans-Joachim Schodlok, Bad Wurzach