Das Büchlein kommt unschuldig daher. Ganz in weiß. Der Titel „Wie ich meine Zeitung verlor“ klingt gleichfalls harmlos, schließlich gibt es täglich eine neue. Der Untertitel „Ein Jahrebuch“ lässt auf einen längeren Zeitraum schließen. Es sind analog zur deutschen Einheit 30 Jahre. Birk Meinhardt schlägt den Bogen vom Journalist als sozialistischer Kader, der er war und dem der Mauerfall eine Karriere als preisgekrönter Reporter bei der Süddeutschen Zeitung eröffnete, bis hin zum Rückblick als Buchautor und scharfer Kritiker seiner einst so geliebten Zeitung.
Vorab: Eine enttäuschte Liebe schmerzt besonders. Die Trennung liegt schon acht Jahre zurück, Birk Meinhardt ist seit langem als Schriftsteller tätig und dem Journalismus inzwischen gänzlich abhold. Aber seine Geschichte ist ein Teil unserer Geschichte „30 Jahre deutsche Einheit“ von Aufbruch und Ernüchterung. Es ist eine Schnittmenge von geschichtlichem Zufall und persönlichem Werden, von Hoffnung, Glück und Enttäuschung. Von euphorischer Nähe einst zu kritischer Distanz heute, von Hinwendung zur Ablehnung. Der 61-Jährige verkörpert deutsche Geschichte mit ostdeutscher Befindlichkeit und mit seiner beißenden Kritik an „der Süddeutschen“, diesem westdeutschen journalistischen Aushängeschild, reiht er sich ein in die vielstimmige Front der Kritiker der so genannten Mainstream-Medien. Ein gemeintes Schimpfwort, das der Ex-Journalist bewusst nicht verwendet, um nicht vorschnell vereinnahmt zu werden. Vermute ich.
Bevor es weitergeht: Warum steht diese Geschichte in BLIX? Weil der 3. Oktober und der runde nationale Geburtstag auch in Oberschwaben ein Thema sind. Und weil wir beobachten können, dass trotz allem feierlichen Einheitsgedöns unser Land in vielem uneins ist, und diese Uneinigkeit nicht selten auch einen geografischen Verlauf entlang der verschwundenen innerdeutschen Grenze nimmt, wo sich das Unverständnis in Ost und West teilt. Nicht zuletzt mit Blick auf die klassischen Medien, deren Mainstream aus dem Westen kommt, und die im Osten besonders ätzend als „Systemmedien“ verhöhnt werden. Als Journalist sollte man davor nicht die Augen verschließen.
Birk Meinhard tut das nicht und erinnert mich daran, dass meine Doktorarbeit sich damit beschäftigt, wo der gebürtige Ost-Berliner herkommt: von der „Wochenpost“. Birk Meinhard ist 1959 in der Hauptstadt der DDR geboren, ich erblickte zwei Jahre früher in Oberschwaben das Licht der Welt und beide erlebten wir im Sommer und Herbst 1990 die letzten Monate der DDR rund um den Alexanderplatz – ohne dass wir uns begegnet sind. Ich als erster Wessi im Berliner Verlag, zu dem auch die Wochenpost gehörte, bei der ich mich erfolgreich um ein Praktikum beworben hatte. Die Wochenzeitung erschien in Millionenauflage und war dennoch „Bückware“, man brauchte Beziehungen, um ein Abo zu ergattern, glücklich wer eines erbte. Es war die Lektüre für das gebildete (sozialistische) Bürgertum, sie war das parteipolitische Zugeständnis der SED an Leser, die keinen Bock auf den Verlautbarungsjournalismus im Neuen Deutschland und der Jungen Welt hatten. Und davon gab es viele.
Die JournalistInnen und RedakteurInnen der Wochenpost waren sich ihres besonderen Status im Mediensystem der SED bewusst und stolz darauf, Parteimitglieder mit besonderem Auftrag zu sein. Auch Birk Meinhard war SED-Mitglied und begeisterter Sportreporter, als solcher zog es ihn von der nachdenklichen Wochenzeitung zur strammen Jungen Welt, dem Zentralorgan der Freien Deutschen Jugend (FDJ), deren Sportteil ihn herausforderte. Doch Sport ohne Politik gab es nicht, und Letztere zog die Grenzen, worüber und wie berichtet wurde. Grenzüberschreitungen wurden nicht geduldet. Artikel erschienen nicht oder willkürlich verändert, es wurde gerügt und ermahnt. Der Mauerfall brachte die Wende.
Dazu schreibt Birk Meinhardt in seinem Buch: „Zur Wende wusste ich, was ich niemals mehr wollte, nämlich mich noch einmal in einen solchen Zwiespalt begeben; die Wende war eine riesige Chance, ein Anlaß, darüber nachzudenken, wo ich selbst zu nachgiebig und zu schwachherzig gewesen war, die berühmte Selbstbefragung, ich glaube ihr nicht ausgewichen zu sein und meine Lehren gezogen zu haben, ich habe mit mir abgemacht, ungesunde und mich ewig beschäftigende Kompromisse nicht mehr einzugehen, soll heißen, sollte jetzt noch einmal ein Text aus politischen Gründen aus der Zeitung fliegen oder sollte jetzt ein Text aus politischen Gründen auch nur zurechtgebogen werden, würde ich in der Zeitung, in der so was geschieht, sicher nicht mehr arbeiten, jedenfalls nicht mehr als Journalist. Vielleicht noch als Pförtner; als Pförtner ginge zur Not noch.“
Ich steckte noch tief in meiner Dissertation als Birk Meinhardt 1992 von Berlin nach München als Sportreporter zur Süddeutschen Zeitung ging. Ein Ossi, der tief im Westen Karriere machte. Den Sport ließ er bald hinter sich und avancierte zum Reporter für die Seite Drei, der Platz für die Edelfedern in der Zeitung. Dass er es konnte, wurde ihm gleich zwei Mal, 1999 und 2001, mit dem renommierten Egon-Erwin-Kisch-Preis zuerkannt. Ausgezeichnet in einem Metier, in dem viel Wert auf Auszeichnungen gelegt wird. Und Meinhardt war begeistert von den Möglichkeiten, die ihm die Süddeutsche bot. „Ich war glücklich bei der SZ.“
Dabei blieb es nicht. Misstrauen sickerte ein und nachdem drei Reportagen von ihm nicht erschienen, fühlte er sich an unselige Zeiten erinnert. In einem Interview in DIE ZEIT wehrt er sich gegen den Vorwurf von Kollegenseite, dass ihm seine Kisch-Preise zu Kopf gestiegen seien und er seine Texte als sakrosankt behandelt sehen wollte. „Wenn Redigieren in Zensieren umschlägt“, dann „schrillen bei mir die Alarmglocken“, erklärt Meinhardt. „Wenn es heißt, wir schreiben noch was rein und nehmen was anderes raus, und du kannst noch mal rübergucken. Da scheinen die Vorwende-Erfahrungen auf.“
Es sind drei gänzlich unterschiedliche Themen, mit denen Meinhardt nicht ins Blatt kam. Einmal war es ein Stück über die Deutsche Bank und deren fragwürdigen Weg ins Investment-Banking, das vom Wirtschaftsressortchef abgelehnt wurde, dann missfiel eine Geschichte über drei junge Rechtsradikale, von denen einer zu Unrecht verurteilt worden war und schließlich landete eine Reportage über den US-amerikanischen Drohnenkrieg, gesteuert vom rheinland-pfälzischen Rammstein aus, im Papierkorb. Es war also nicht das Thema, sondern der Tenor der Geschichten, der dem Ressortchef nicht schmeckte, mutmaßt Meinhardt. Was bei ihm zu „zunehmenden Unwohlsein“ führte. Die drei Reportagen finden sich im Buch.
Letztlich waren es diese Erfahrungen, die undiskutiert blieben, wie er behauptet, gepaart mit der Beobachtung einer Verengung, die seiner Meinung nach andere Perspektiven nicht mehr zuließ, die Birk Meinhardt in die Emigration führten, zurück in den Osten, wo er als Schriftsteller reüssierte. Nach Jahren des Abstands und gut platziert im Jubiläumsjahr kommt nun die Abrechnung. Als „Geschichte einer Desillusionierung“ bezeichnet der Autor sein Buch. Und indem er dem Vorzeigeblatt im Westen bewusste Informationslenkung vorwirft, trifft er das journalistische Establishment in seinem Selbstverständnis – als vierte und unabdingbare Gewalt für ein demokratisches Gemeinwesen – zu einem Zeitpunkt, wo zur deutschen Einheit wieder einmal Girlanden geflochten werden zum Lob der freien Presse. Stattdessen soll es nach Zensur riechen. Das ist fies, als ob die Zunft nicht schon genug Probleme hätte.
Als der Sportreporter 1992 nach München zog und ich noch bis 1995 im westfälischen Münster mich mit den Lebens- und Berufserfahrungen von DDR-Journalisten beschäftigte, steckte das Internet noch in den Kinderschuhen, und das Smartphone erschien noch nicht einmal im Traum. Das änderte sich nach der Jahrtausendwende in Lichtgeschwindigkeit. Stand heute kann jeder Journalismus. Dank Social Media reicht es, drei gerade Sätze sprechen zu können, um weltweit wahrgenommen zu werden. Und man muss auch nicht amerikanischer Präsident sein, um auf Twitter den größten Bullshit absondern zu dürfen. Jeder darf es und jede! Welch‘ fantastische neue Medienwelt. Vergesst die alte Zeitung, die womöglich noch mit der Post kommt. Lächerlich!
Aber nein, nie war die Kritik an den klassischen Medien, Presse, Funk und Fernsehen lauter, ätzender, feindseliger. Warum dieser Eifer mit Geifer? Ist es ein Phantomschmerz, der die Kritiker plagt oder liegt ein Missverständnis vor oder haben die Lästermäuler womöglich einfach recht?
Was Birk Meinhardt betrifft, legt er Wert darauf, dass er nicht einen Zensor am Werk sieht, der Themen und Tenor bestimmt, sondern dass journalistische Sensoren einseitig ausgerichtet sind, die unliebsame Themen, die der eigenen Haltung widersprechen, ausblenden und Fakten drehen, bis sie ins eigene Bild passen. Das ist die Light-Version dessen, was Meinhardt im SED-Journalismus selbst erlebt hat. Und von seinem Aufbruch in den Westen hatte er anderes erhofft und erwartet. Er endete mit Enttäuschung. Im ZEIT-Interview merkt der Schriftsteller an: „Im Übrigen würde ich die Ostdeutschen in der heutigen Zeit als Seismografen bezeichnen. Ich frage mich, warum sich so wenige in den durchweg westlich dominierten Institutionen fragen, was dahintersteckt, wenn jetzt vor allem ältere Ost-Intellektuelle mit jeder Menge Erfahrung in zwei Systemen mehr und mehr Alarmsignale senden.“ Deutschland, uneinig Vaterland! Also streiten wir weiter.
„Die Süddeutsche“ hat sich zu den Vorwürfen ihrer ehemaligen Edelfeder nur verhalten geäußert: sie seien „irreführend und nicht zutreffend“.
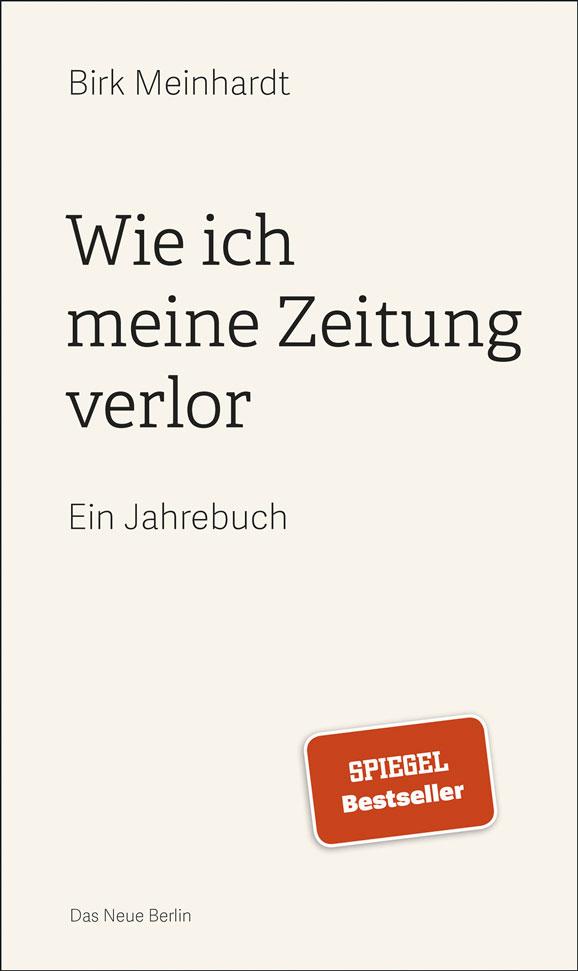 Taschenbuch:
Taschenbuch:
144 Seiten
Verlag:
Das Neue Berlin
1. Auflage (20. August 2020)
Preis: 15 Euro
Autor: Roland Reck
Foto: Verlag

