Dieses Jahr kann nicht unkommentiert bleiben. Dazu ist es zu außergewöhnlich. 2020, diese besondere Jahreszahl, hat zu Beginn noch nicht erkennen lassen, womit wir überrascht wurden. Corona, eine Pandemie, die sich entsprechend der globalen Reise- und Handelsströme rasend schnell über den Globus ausbreitete, hält die Welt im Würgegriff. Einem nahezu weltweiten Shutdown in der ersten Hälfte des Jahres folgte nun die erneute Einschränkung des öffentlichen und privaten Lebens. Das Virus gefährdet Leben, und der staatliche Kampf dagegen schafft inzwischen zivilen Unmut und Protest.
In der Konsequenz bedeutet dies aber, dass wir es nicht nur mit einer galoppierenden Erderwärmung und einem grassierenden Artensterben zu tun haben, sondern uns auch ein „Zeitalter der Pandemien“ droht, wie der internationale Biodiversitätsrat IPBES, ein weltweiter Zusammenschluss von Wissenschaftlern ähnlich dem Weltklimarat, jüngst noch einmal warnte. Die Ursache ist bekannt: Es ist ein Wirtschaftssystem, das Naturzerstörung bedingt. „Der Weg zu Zoonosen und Pandemien“ sei die stetige Ausweitung und Intensivierung der Land- und Forstwirtschaft und die dahinter stehenden, auf Verschwendung und Überkonsum angelegten Produktions- und Handelssysteme, die die Natur zerstörten und den Kontakt zwischen Wildtieren, Vieh, Krankheitserregern und Menschen erhöhten, konstatieren die Experten. (Die dänischen Nerze lassen grüßen.) „Wir müssen Klimaschutz, Naturschutz und Gesundheitsschutz zusammen denken“, fordert IPBES-Generalsekretärin Anne Larigauderie. Abhilfe sehen die Forscher in einem konsequenten Naturschutz und einer nachhaltigen Lebensweise.
Angesichts der verheerenden Kosten von Klimakatastrophe und Pandemien rechne sich Prävention auch ökonomisch, geben sich die Wissenschaftler optimistisch. Ein wunderschöner Planet mit vielen Ökosystemleistungen und viel weniger Tote durch Pandemien seien die Belohnung für ein Umsteuern. „Das ist doch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis“, zitiert die Süddeutsche Zeitung den Studienleiter Peter Daszak, Zoologe und Virenexperte in den USA.
BLIX hat bereits zum Lockdown im April diesen Jahres 24 Personen des öffentlichen Lebens gefragt: „Was kommt, wenn nichts bleibt wie es war?“ (Hannes Wader) Und weiter: „Was ändern wir, um nach der Corona-Pandemie die noch größere Klimakatastrophe zu verhindern?“ Geantwortet haben von Ministerpräsident Winfried Kretschmann über Prof. Wolfgang Ertel von der Hochschule Ravensburg-Weingarten und dem katholischen Dekan Ekkehard Schmid, bis hin zur Ulmer Kabarettistin Heike Sauer viele weitere, von denen im Juni-BLIX allerdings aus Platzgründen nur Auszüge aus einer begrenzten Auswahl an Statements veröffentlicht wurden. (Alle lassen sich online nachlesen.) Und da die meisten Statements zum Ende dieses „unvergesslichen Jahres“, so der Titel des Juni-BLIX, nicht weniger aktuell sind als vor einem halben Jahr folgt hier eine Zusammenschau – mit Blick auf das kommende Jahr.
 Beginnend mit der politischen Prominenz. Ministerpräsident Winfried Kretschmann sieht die Pandemie als Zäsur und rät, „danach nicht einfach wieder zur Tagesordnung überzugehen“. Denn: „Den Virus werden wir spätestens mit einem Impfstoff besiegen können. Doch gegen die Erderwärmung gibt es keine Impfung. Die Klimakrise wird bleiben.“ Kretschmann warnt vor den Folgen, aber will die Krise auch als Chance nutzen. „Wir müssen die Chance ergreifen, die Wirtschaft nach der Corona-Krise klug, nachhaltig und klimaverträglich neu zu strukturieren. Unser großes Ziel muss es sein, das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Wenn es uns weiterhin gelingt, Ökologie und Ökonomie miteinander zu verbinden, dann machen wir unsere heimischen Unternehmen zur Nummer eins bei Ressourceneffizienz und Umwelttechnologien. So kann Nachhaltigkeit zum echten Markenzeichen unseres Landes werden.“ Der grüne Spitzenkandidat für die kommende Landtagswahl hält ausdrücklich am Wirtschaftswachstum als Ziel fest, darin folgen ihm nicht alle, das zeigt auch die neu entstandene „Klimaliste“, die befeuert durch die Fridays-for-Future-Bewegung sich ganz aktuell auch in Baden-Württemberg um die Teilnahme an der Landtagswahl bemüht und dem grünen Vormann offensichtlich Kopfzerbrechen bereitet.
Beginnend mit der politischen Prominenz. Ministerpräsident Winfried Kretschmann sieht die Pandemie als Zäsur und rät, „danach nicht einfach wieder zur Tagesordnung überzugehen“. Denn: „Den Virus werden wir spätestens mit einem Impfstoff besiegen können. Doch gegen die Erderwärmung gibt es keine Impfung. Die Klimakrise wird bleiben.“ Kretschmann warnt vor den Folgen, aber will die Krise auch als Chance nutzen. „Wir müssen die Chance ergreifen, die Wirtschaft nach der Corona-Krise klug, nachhaltig und klimaverträglich neu zu strukturieren. Unser großes Ziel muss es sein, das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Wenn es uns weiterhin gelingt, Ökologie und Ökonomie miteinander zu verbinden, dann machen wir unsere heimischen Unternehmen zur Nummer eins bei Ressourceneffizienz und Umwelttechnologien. So kann Nachhaltigkeit zum echten Markenzeichen unseres Landes werden.“ Der grüne Spitzenkandidat für die kommende Landtagswahl hält ausdrücklich am Wirtschaftswachstum als Ziel fest, darin folgen ihm nicht alle, das zeigt auch die neu entstandene „Klimaliste“, die befeuert durch die Fridays-for-Future-Bewegung sich ganz aktuell auch in Baden-Württemberg um die Teilnahme an der Landtagswahl bemüht und dem grünen Vormann offensichtlich Kopfzerbrechen bereitet.
 Roland Roth ist erstaunt und skeptisch zugleich. Der Wetterexperte aus Bad Schussenried merkt kritisch an: „Kaum zu glauben, was in Corona-Zeiten alles möglich ist. (…) Plötzlich verfügt unser Staat über Unsummen an Finanzmitteln, die für den nachhaltigen Klimaschutz und die dringend nötige Verkehrswende noch nicht mal im Ansatz vorhanden waren.“ Er wünscht sich „eine ähnliche Entschlossenheit beim Klimaschutz. (…) Aber ich befürchte, es geht danach genauso gedankenlos weiter, und wir geben sogar noch ‚Vollgas‘, um das Versäumte auf- und nachzuholen. Anstatt effiziente Nachhaltigkeit Kommerz bis zum Gehtnichtmehr und grenzenloser Wachstumswahn.“
Roland Roth ist erstaunt und skeptisch zugleich. Der Wetterexperte aus Bad Schussenried merkt kritisch an: „Kaum zu glauben, was in Corona-Zeiten alles möglich ist. (…) Plötzlich verfügt unser Staat über Unsummen an Finanzmitteln, die für den nachhaltigen Klimaschutz und die dringend nötige Verkehrswende noch nicht mal im Ansatz vorhanden waren.“ Er wünscht sich „eine ähnliche Entschlossenheit beim Klimaschutz. (…) Aber ich befürchte, es geht danach genauso gedankenlos weiter, und wir geben sogar noch ‚Vollgas‘, um das Versäumte auf- und nachzuholen. Anstatt effiziente Nachhaltigkeit Kommerz bis zum Gehtnichtmehr und grenzenloser Wachstumswahn.“
 Von solchen Befürchtungen hält der Ravensburger CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Müller nichts. Der Jurist warnt: „Wir sollten uns hüten, Corona-Krise und Klimawandel gleichzusetzen. Innerhalb kürzester Zeit sind an den Folgen der Viruserkrankung zehntausende Menschen verstorben, während die Erderwärmung uns weiterhin Spielräume für vernünftige Entscheidungen lässt. Insofern gilt: Was vor Corona in der Klimapolitik richtig war, ist auch danach richtig. Und da sind wir in Deutschland bereits auf einem guten Weg: Mit dem Klimapaket ist die Große Koalition trotz aller Kritik schon in Vorleistung gegangen.“ Und sollte es wegen Corona zu einer weltweiten Wirtschaftskrise kommen, „dann werden wir auch den Herausforderungen der Klima- und Umweltpolitik nun erst recht pragmatisch und wirtschaftlich vernünftig begegnen müssen“, fordert der Politiker. „Das war meine Überzeugung in der Vergangenheit und bleibt das klare Ziel für die Zukunft.“
Von solchen Befürchtungen hält der Ravensburger CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Müller nichts. Der Jurist warnt: „Wir sollten uns hüten, Corona-Krise und Klimawandel gleichzusetzen. Innerhalb kürzester Zeit sind an den Folgen der Viruserkrankung zehntausende Menschen verstorben, während die Erderwärmung uns weiterhin Spielräume für vernünftige Entscheidungen lässt. Insofern gilt: Was vor Corona in der Klimapolitik richtig war, ist auch danach richtig. Und da sind wir in Deutschland bereits auf einem guten Weg: Mit dem Klimapaket ist die Große Koalition trotz aller Kritik schon in Vorleistung gegangen.“ Und sollte es wegen Corona zu einer weltweiten Wirtschaftskrise kommen, „dann werden wir auch den Herausforderungen der Klima- und Umweltpolitik nun erst recht pragmatisch und wirtschaftlich vernünftig begegnen müssen“, fordert der Politiker. „Das war meine Überzeugung in der Vergangenheit und bleibt das klare Ziel für die Zukunft.“
 Dem Primat der Wirtschaft in althergebrachten Bahnen folgt Simone Sommer nicht. Die Professorin an der Uni Ulm ist als Leiterin des Instituts für Evolutionsökologie und Naturschutzgenomik Expertin für Zoonosen: für Infektionskrankheiten, die vom Tier zum Mensch und umgekehrt gelangen. Dazu zählt auch das Corona-Virus. Die Wissenschaftlerin hofft, „dass bei den ganzen schlimmen Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise eines klar wird: Arten-, Umwelt- und auch Klimaschutz müssen einen höheren Stellenwert bekommen – nicht zuletzt im Interesse unserer eigenen Gesundheit.“
Dem Primat der Wirtschaft in althergebrachten Bahnen folgt Simone Sommer nicht. Die Professorin an der Uni Ulm ist als Leiterin des Instituts für Evolutionsökologie und Naturschutzgenomik Expertin für Zoonosen: für Infektionskrankheiten, die vom Tier zum Mensch und umgekehrt gelangen. Dazu zählt auch das Corona-Virus. Die Wissenschaftlerin hofft, „dass bei den ganzen schlimmen Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise eines klar wird: Arten-, Umwelt- und auch Klimaschutz müssen einen höheren Stellenwert bekommen – nicht zuletzt im Interesse unserer eigenen Gesundheit.“
 Ob die Pandemie „eine wirkliche Zäsur, ein Epochenbruch und Paradigmenwechsel darstellt“, das ließe sich erst aus einer gewissen zeitlichen Distanz feststellen, meint Martin Buck, Präsident der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben. Aber „eine zentrale Erkenntnis, die wir meines Erachtens aus der Krise schon jetzt ziehen können, ist, wie fragil unsere Systeme sind. Sind die global vernetzten Märkte gestört und brechen die weltweiten Transportketten ein, dann geraten die einzelnen Volkswirtschaften in einen Strudel, den sie entweder gar nicht oder nur mit den allergrößten Anstrengungen und unvorstellbar viel Geld gegensteuern können.“ Der Unternehmer räumt ein: „Wir stehen vor großen Herausforderungen. In einer Zeit vor Corona galt die Klimakrise als eine der wohl größten unserer Zeit. Das wird in Post-Corona-Zeiten nicht anders sein.“ Seine Schlussfolgerung: „Es gibt viel zu tun. Was wir brauchen, sind verlässliche Partner in der Politik mit dem Wissen um die zentrale Stellung der Wirtschaft bei der Bewältigung aller Krisen und Herausforderungen.“
Ob die Pandemie „eine wirkliche Zäsur, ein Epochenbruch und Paradigmenwechsel darstellt“, das ließe sich erst aus einer gewissen zeitlichen Distanz feststellen, meint Martin Buck, Präsident der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben. Aber „eine zentrale Erkenntnis, die wir meines Erachtens aus der Krise schon jetzt ziehen können, ist, wie fragil unsere Systeme sind. Sind die global vernetzten Märkte gestört und brechen die weltweiten Transportketten ein, dann geraten die einzelnen Volkswirtschaften in einen Strudel, den sie entweder gar nicht oder nur mit den allergrößten Anstrengungen und unvorstellbar viel Geld gegensteuern können.“ Der Unternehmer räumt ein: „Wir stehen vor großen Herausforderungen. In einer Zeit vor Corona galt die Klimakrise als eine der wohl größten unserer Zeit. Das wird in Post-Corona-Zeiten nicht anders sein.“ Seine Schlussfolgerung: „Es gibt viel zu tun. Was wir brauchen, sind verlässliche Partner in der Politik mit dem Wissen um die zentrale Stellung der Wirtschaft bei der Bewältigung aller Krisen und Herausforderungen.“
 Dass Unternehmer nicht nur Betriebswirtschaft können, belegt Uli Zimmermann, der Bierbrauer aus Berg bei Ehingen blickt über den Tellerrand und wünscht sich, „dass wir aus der Coronakrise lernen. Unser Wohlstand basiert auch auf den verlängerten Werkbänken, die wir in aller Welt haben. Bekommen die Menschen an diesen fernen Werkbänken einen gerechten Lohn? Ich wünsche mir, dass wir regionale Wirtschaftskreisläufe stärken, dass wir nicht nur von anderen einfordern, gerechte Preise zu bezahlen, sondern dass wir dies selber tun. Ich wünsche mir, dass wir daran arbeiten die Ursachen abzumildern, die Menschen veranlasst, ihre Heimat zu verlassen. Ich wünsche mir, dass wir Europa stärken, indem wir von unserem Vorteil als Exportweltmeister anderen Ländern Europas etwas abgeben.“ Und ausdrücklich wünscht er sich, dass auch Vieles so bleibt, „weil es gut ist: das menschliche Miteinander, die Fürsorge untereinander“.
Dass Unternehmer nicht nur Betriebswirtschaft können, belegt Uli Zimmermann, der Bierbrauer aus Berg bei Ehingen blickt über den Tellerrand und wünscht sich, „dass wir aus der Coronakrise lernen. Unser Wohlstand basiert auch auf den verlängerten Werkbänken, die wir in aller Welt haben. Bekommen die Menschen an diesen fernen Werkbänken einen gerechten Lohn? Ich wünsche mir, dass wir regionale Wirtschaftskreisläufe stärken, dass wir nicht nur von anderen einfordern, gerechte Preise zu bezahlen, sondern dass wir dies selber tun. Ich wünsche mir, dass wir daran arbeiten die Ursachen abzumildern, die Menschen veranlasst, ihre Heimat zu verlassen. Ich wünsche mir, dass wir Europa stärken, indem wir von unserem Vorteil als Exportweltmeister anderen Ländern Europas etwas abgeben.“ Und ausdrücklich wünscht er sich, dass auch Vieles so bleibt, „weil es gut ist: das menschliche Miteinander, die Fürsorge untereinander“.
 Ähnlich sieht es Martin Gerster, der SPD-Bundestagsabgeordneter aus Biberach erkennt als Folge der Krise eine größere Wertschätzung, „was wirklich zählt im Leben: die gegenseitige Zuwendung, das Füreinander-da-sein, das Zurückstellen egoistischen Gewinnstrebens auf Kosten anderer. Diese Erfahrung nachhaltig wirksam werden zu lassen, kann Kreativimpuls für neue Strukturen in Richtung einer gerechteren, sozialeren und Planeten schützenderen Wirtschaftsweise sein“. Gerster beschreibt aber auch das Dilemma, indem er feststellt, dass im Unterschied zu einer Virusinfektion „die datenbasierten Zukunftsprognosen“ von Klimaforschern „nicht sinnlich erfahrbar sind“ und dennoch von höchster Brisanz seien.
Ähnlich sieht es Martin Gerster, der SPD-Bundestagsabgeordneter aus Biberach erkennt als Folge der Krise eine größere Wertschätzung, „was wirklich zählt im Leben: die gegenseitige Zuwendung, das Füreinander-da-sein, das Zurückstellen egoistischen Gewinnstrebens auf Kosten anderer. Diese Erfahrung nachhaltig wirksam werden zu lassen, kann Kreativimpuls für neue Strukturen in Richtung einer gerechteren, sozialeren und Planeten schützenderen Wirtschaftsweise sein“. Gerster beschreibt aber auch das Dilemma, indem er feststellt, dass im Unterschied zu einer Virusinfektion „die datenbasierten Zukunftsprognosen“ von Klimaforschern „nicht sinnlich erfahrbar sind“ und dennoch von höchster Brisanz seien.
 Auch Jost Einstein beschreibt ein Dilemma: „Wissenschaft und die Politik haben die wachsende Gefahr von Pandemien schon lange erkannt, und in vielen Staaten der Welt wurden vorausschauend Pandemiepläne erstellt. Die Pläne haben alle drei Dinge gemeinsam: 1. Sie beschreiben die Problematik und die Risiken durch eine Pandemie treffend. 2. Sie zeigen Möglichkeiten der Vermeidung und Bekämpfung auf. 3. Sie wurden nie umgesetzt.“ Dennoch lobt der Ökologe und langjährige Leiter des Naturschutzgebietes Federsee die deutsche Politik für ihr entschlossenes Handeln. „Das war mutig, aber die Bevölkerung hat verstanden und trägt die Maßnahmen mit.“ Darin sieht der Naturschützer auch eine „Vorlage für die Bewältigung der drohenden Klimakatastrophe“ und fordert von der Politik „ein entschlossenes Handeln zugunsten einer wirklich nachhaltigen Wirtschaftspolitik – jetzt, wo noch aktiv gesteuert werden kann und wir noch nicht mit dem Rücken zur Wand stehen. Und ich wünsche mir, dass wir Bürger die notwendigen Maßnahmen mittragen. Es wäre doch unverzeihlich, wenn unsere Kinder in zwanzig Jahren über uns sagen müssten: Sie haben die Problematik und die Risiken einer Klimakatastrophe treffend beschrieben, sie haben auch Klimaschutzpläne aufgestellt – sie haben diese aber nie umgesetzt“.
Auch Jost Einstein beschreibt ein Dilemma: „Wissenschaft und die Politik haben die wachsende Gefahr von Pandemien schon lange erkannt, und in vielen Staaten der Welt wurden vorausschauend Pandemiepläne erstellt. Die Pläne haben alle drei Dinge gemeinsam: 1. Sie beschreiben die Problematik und die Risiken durch eine Pandemie treffend. 2. Sie zeigen Möglichkeiten der Vermeidung und Bekämpfung auf. 3. Sie wurden nie umgesetzt.“ Dennoch lobt der Ökologe und langjährige Leiter des Naturschutzgebietes Federsee die deutsche Politik für ihr entschlossenes Handeln. „Das war mutig, aber die Bevölkerung hat verstanden und trägt die Maßnahmen mit.“ Darin sieht der Naturschützer auch eine „Vorlage für die Bewältigung der drohenden Klimakatastrophe“ und fordert von der Politik „ein entschlossenes Handeln zugunsten einer wirklich nachhaltigen Wirtschaftspolitik – jetzt, wo noch aktiv gesteuert werden kann und wir noch nicht mit dem Rücken zur Wand stehen. Und ich wünsche mir, dass wir Bürger die notwendigen Maßnahmen mittragen. Es wäre doch unverzeihlich, wenn unsere Kinder in zwanzig Jahren über uns sagen müssten: Sie haben die Problematik und die Risiken einer Klimakatastrophe treffend beschrieben, sie haben auch Klimaschutzpläne aufgestellt – sie haben diese aber nie umgesetzt“.
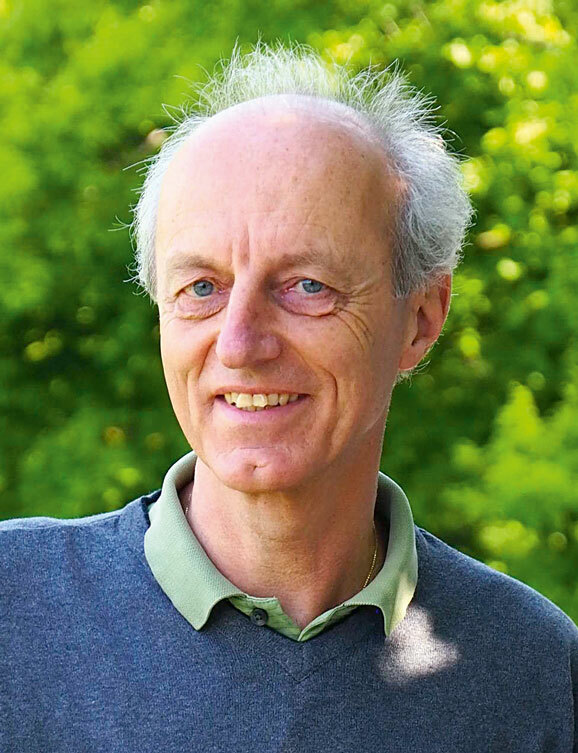 Dem schließt sich Prof. Wolfgang Ertel an. Der Leiter des Instituts für künstliche Intelligenz an der Hochschule Ravensburg-Weingarten ist Mitglied bei den Scientists for Future und auch er lobt die Politik für ihr konsequentes Handeln in der Corona-Krise. „Die wichtigste Lehre für mich ist, dass unsere Politik mutig handeln kann, um eine Katastrophe zu verhindern. Das zeigt sie momentan sehr schön in der Corona-Pandemie. Der Klimawandel wird unsere Kinder in eine viel dramatischere Katastrophe führen. Daher fordere ich von allen Politikern auf allen Ebenen - kommunal, in Stuttgart sowie in Berlin - endlich auch beim Umweltschutz so konsequent zu handeln.“
Dem schließt sich Prof. Wolfgang Ertel an. Der Leiter des Instituts für künstliche Intelligenz an der Hochschule Ravensburg-Weingarten ist Mitglied bei den Scientists for Future und auch er lobt die Politik für ihr konsequentes Handeln in der Corona-Krise. „Die wichtigste Lehre für mich ist, dass unsere Politik mutig handeln kann, um eine Katastrophe zu verhindern. Das zeigt sie momentan sehr schön in der Corona-Pandemie. Der Klimawandel wird unsere Kinder in eine viel dramatischere Katastrophe führen. Daher fordere ich von allen Politikern auf allen Ebenen - kommunal, in Stuttgart sowie in Berlin - endlich auch beim Umweltschutz so konsequent zu handeln.“
 Die Künstlerin Marlis Glaser hofft auf ein Umdenken und Umlenken in der Gesellschaft. „Ich habe den Eindruck - hoffentlich stimmt er wirklich - dass derzeit doch einige Menschen die Verbindung zum Problem des Klimawandels herstellen und sich überlegen, ihr Leben zu ändern, also sich fragen: muss ich so viel fliegen, rumfahren, konsumieren? Denn dass die gesellschaftlichen, ökonomischen und individuellen Nöte und Probleme noch um einiges größer würden in Folge des Klimawandels als in der derzeitigen Pandemie, diese Erkenntnis ist bereits in manchen Kommentaren und Diskussionen zu hören. Für mich wäre es ein wunderbares Ergebnis der Covid-19-Pandemie, wenn viele Menschen nun merken, dass man mit weniger Konsum auch ganz gut leben kann, sogar besser, entspannter, weniger anstrengend.“ Ihr Statement endet mit der Feststellung: „Es hört sich so an, als wäre ich dankbar, dass diese Corona-Krise kam. Auf eine bestimmte Weise schon. Denn es ist doch die Mehrheit der Menschen, die nicht nach ihrem Wissen handelt, sondern sich erst zu ändern bereit ist, wenn es wehtut. Nur, treffen tut es leider alle, auch diejenigen, die bisher verantwortungsvoll in ihrem Handeln waren.“
Die Künstlerin Marlis Glaser hofft auf ein Umdenken und Umlenken in der Gesellschaft. „Ich habe den Eindruck - hoffentlich stimmt er wirklich - dass derzeit doch einige Menschen die Verbindung zum Problem des Klimawandels herstellen und sich überlegen, ihr Leben zu ändern, also sich fragen: muss ich so viel fliegen, rumfahren, konsumieren? Denn dass die gesellschaftlichen, ökonomischen und individuellen Nöte und Probleme noch um einiges größer würden in Folge des Klimawandels als in der derzeitigen Pandemie, diese Erkenntnis ist bereits in manchen Kommentaren und Diskussionen zu hören. Für mich wäre es ein wunderbares Ergebnis der Covid-19-Pandemie, wenn viele Menschen nun merken, dass man mit weniger Konsum auch ganz gut leben kann, sogar besser, entspannter, weniger anstrengend.“ Ihr Statement endet mit der Feststellung: „Es hört sich so an, als wäre ich dankbar, dass diese Corona-Krise kam. Auf eine bestimmte Weise schon. Denn es ist doch die Mehrheit der Menschen, die nicht nach ihrem Wissen handelt, sondern sich erst zu ändern bereit ist, wenn es wehtut. Nur, treffen tut es leider alle, auch diejenigen, die bisher verantwortungsvoll in ihrem Handeln waren.“
 Auf die Krise als Chance zum Umhandeln verweist auch Ekkehard Schmid, katholischer Dekan für Allgäu-Oberschwaben. „Wo es lebensgefährlich wird, beginnen wir neu und anders zu leben – hoffentlich. Denn das Trägheitsmoment ist groß und die Vergesslichkeit auch.“ Im Wissen um die Versuchung mahnt der Geistliche: „Die ökologischen Vorteile dieser Krise dürfen nicht wie ein Jojo-Effekt verspielt werden! Es ist eine Binsenweisheit, dass globale Krisen auch gemeinsam und nicht nationalistisch oder gar egoistisch à la Nudeln und Klopapier gelöst werden können. Solidarität meint nicht nur Internationalität, sondern Gerechtigkeit und damit der Blick auf die Verlierer, die Armen, und nicht nur auf die Gewinner, die Reichen. ‚Und fange bei mir an‘ – heißt es in einem Gebet. Nur wenn ALLE damit anfangen und vor allem jene, die an den Weichen sitzen, wird etwas geschehen. Umkehr ist gewiss nötig, aber Gott sei Dank auch noch möglich. Diese umfassende Krise ist für mich daher keine Strafe Gottes, sondern ein Hinweis seiner Eselsgeduld mit uns.“
Auf die Krise als Chance zum Umhandeln verweist auch Ekkehard Schmid, katholischer Dekan für Allgäu-Oberschwaben. „Wo es lebensgefährlich wird, beginnen wir neu und anders zu leben – hoffentlich. Denn das Trägheitsmoment ist groß und die Vergesslichkeit auch.“ Im Wissen um die Versuchung mahnt der Geistliche: „Die ökologischen Vorteile dieser Krise dürfen nicht wie ein Jojo-Effekt verspielt werden! Es ist eine Binsenweisheit, dass globale Krisen auch gemeinsam und nicht nationalistisch oder gar egoistisch à la Nudeln und Klopapier gelöst werden können. Solidarität meint nicht nur Internationalität, sondern Gerechtigkeit und damit der Blick auf die Verlierer, die Armen, und nicht nur auf die Gewinner, die Reichen. ‚Und fange bei mir an‘ – heißt es in einem Gebet. Nur wenn ALLE damit anfangen und vor allem jene, die an den Weichen sitzen, wird etwas geschehen. Umkehr ist gewiss nötig, aber Gott sei Dank auch noch möglich. Diese umfassende Krise ist für mich daher keine Strafe Gottes, sondern ein Hinweis seiner Eselsgeduld mit uns.“
 Und während der Gottesmann auf die „Eselsgeduld“ des Schöpfers verweist, spricht der Biberacher Oberbürgermeister Norbert Zeidler von Demut. „Einerseits hoffe ich sehr, dass sich so wenig wie möglich ändern wird: dass unsere Wirtschaft diese Krise einigermaßen glimpflich übersteht, dass unsere lebendigen und attraktiven Innenstädte nicht zu Problemzonen werden, weil eine Insolvenzwelle über Einzelhandel und Gastronomie rollt. (…) Andererseits können wir aus dieser Krise vielleicht auch manches nachhaltig lernen. Sie ist eine große Demutserfahrung für eine ganze Generation in unserem Land.“
Und während der Gottesmann auf die „Eselsgeduld“ des Schöpfers verweist, spricht der Biberacher Oberbürgermeister Norbert Zeidler von Demut. „Einerseits hoffe ich sehr, dass sich so wenig wie möglich ändern wird: dass unsere Wirtschaft diese Krise einigermaßen glimpflich übersteht, dass unsere lebendigen und attraktiven Innenstädte nicht zu Problemzonen werden, weil eine Insolvenzwelle über Einzelhandel und Gastronomie rollt. (…) Andererseits können wir aus dieser Krise vielleicht auch manches nachhaltig lernen. Sie ist eine große Demutserfahrung für eine ganze Generation in unserem Land.“
 Dass aufgrund von Corona die wirtschaftlichen und finanziellen Spielräume kleiner werden, darauf macht auch Stefanie Bürkle aufmerksam, CDU-Landrätin in Sigmaringen. „Corona führt bei vielen zu wirtschaftlichen Sorgen und auch den öffentlichen Haushalten in den Städten, Gemeinden und Landkreisen fehlen Einnahmen. Die Rettungspakete des Staates lassen die Verschuldung steigen. Das bedeutet, dass der Staat in den nächsten Jahren vieles nicht mehr in gewohnter Weise wird leisten können. Wir werden als Gesellschaft unsere Prioritäten neu setzen und jeder Einzelne wird für sich und sein Umfeld wieder mehr Eigenverantwortung übernehmen müssen.“ Dabei ist die Kommunalpolitikerin zuversichtlich, denn sie erlebe in diesen Tagen „auch einen Zusammenhalt, ein Miteinander, und ein gegenseitiges aufeinander Rücksichtnehmen und füreinander Sorgen, wie es in normalen Zeiten nur selten zu spüren ist. Menschen leben Verzicht, zeigen Flexibilität, Kreativität, Innovationsgeist und Gemeinsinn“.
Dass aufgrund von Corona die wirtschaftlichen und finanziellen Spielräume kleiner werden, darauf macht auch Stefanie Bürkle aufmerksam, CDU-Landrätin in Sigmaringen. „Corona führt bei vielen zu wirtschaftlichen Sorgen und auch den öffentlichen Haushalten in den Städten, Gemeinden und Landkreisen fehlen Einnahmen. Die Rettungspakete des Staates lassen die Verschuldung steigen. Das bedeutet, dass der Staat in den nächsten Jahren vieles nicht mehr in gewohnter Weise wird leisten können. Wir werden als Gesellschaft unsere Prioritäten neu setzen und jeder Einzelne wird für sich und sein Umfeld wieder mehr Eigenverantwortung übernehmen müssen.“ Dabei ist die Kommunalpolitikerin zuversichtlich, denn sie erlebe in diesen Tagen „auch einen Zusammenhalt, ein Miteinander, und ein gegenseitiges aufeinander Rücksichtnehmen und füreinander Sorgen, wie es in normalen Zeiten nur selten zu spüren ist. Menschen leben Verzicht, zeigen Flexibilität, Kreativität, Innovationsgeist und Gemeinsinn“.
 Dem Lob der Landrätin entspricht der gute Vorsatz der Ulmer Kabarettistin Heike Sauer: „Alles kommt gerade ans Licht: Das Tier im Menschen (Klopapier!), aber genauso der Herzensmensch. Es geht wieder ums Wesentliche. Das Ranking meiner Werteskala hat sich verändert. Mir wird bewusst, wie wichtig mir das unterstützende Miteinander ist. Ich werde das alles aufschreiben, damit ich es nicht vergesse, wenn alles wieder losgeht. Ich werde es aufschreiben, damit ich nicht genau so weitermache, wie ich aufgehört habe. Eben nicht als Krone der Schöpfung, das Beste für mich rausziehend, sondern mit der Frage: Was habe ich zu geben? Was kann ich beitragen? Es fängt bei mir an. Wenn ich mich verändere, kann sich auch im Großen was verändern. Und wir sehen gerade: Es kann sich tatsächlich alles von heute auf morgen ändern. Ich kann mein Ändern leben. Und ich wette mit Ihnen, es kommt etwas Besseres nach, weil aus dem größten Mist der beste Dünger wird. Irgendwie, irgendwo, irgendwann geht es weiter. Das Wann liegt nicht in meiner Hand, aber das Wie.“
Dem Lob der Landrätin entspricht der gute Vorsatz der Ulmer Kabarettistin Heike Sauer: „Alles kommt gerade ans Licht: Das Tier im Menschen (Klopapier!), aber genauso der Herzensmensch. Es geht wieder ums Wesentliche. Das Ranking meiner Werteskala hat sich verändert. Mir wird bewusst, wie wichtig mir das unterstützende Miteinander ist. Ich werde das alles aufschreiben, damit ich es nicht vergesse, wenn alles wieder losgeht. Ich werde es aufschreiben, damit ich nicht genau so weitermache, wie ich aufgehört habe. Eben nicht als Krone der Schöpfung, das Beste für mich rausziehend, sondern mit der Frage: Was habe ich zu geben? Was kann ich beitragen? Es fängt bei mir an. Wenn ich mich verändere, kann sich auch im Großen was verändern. Und wir sehen gerade: Es kann sich tatsächlich alles von heute auf morgen ändern. Ich kann mein Ändern leben. Und ich wette mit Ihnen, es kommt etwas Besseres nach, weil aus dem größten Mist der beste Dünger wird. Irgendwie, irgendwo, irgendwann geht es weiter. Das Wann liegt nicht in meiner Hand, aber das Wie.“
Emma Junker,
Fridays for future
„Das wünsche ich mir für 2021“

Emma Junker ist 17 Jahre alt, wohnt in der Nähe von Amtzell und geht zur Edith-Stein-Schule nach Ravensburg, wo sie sich schon von Beginn an bei FridaysforFuture engagiert, als deren Vertreterin sie auch in der Klimakommission der Stadt Ravensburg mitarbeitet.
RAVENSBURG. 2020. Was für ein Jahr! Für die Meisten wohl ein Jahr mit hauptsächlich negativen Erinnerungen. Für mich persönlich als Schülerin, Aktivistin und nicht zuletzt als Jugendliche heißt das natürlich auch Einschränkungen in meiner Freizeitgestaltung und die großen Veränderungen in meinem Bildungsweg durch den Lockdown. Ich sehe aber auch ein Jahr des Wandels, des Umbruchs und des neuen Denkens.
In unsere Bewegung FridaysforFuture stecken viele, vor allem junge Menschen gerade große Hoffnungen. Jedoch ist und wird es keine leichte Aufgabe sein, eine Bewegung, die von Aktionen, Gemeinschaft und Präsenz auf der politischen Tagesordnung lebt, in Zeiten, in denen ein Virus oberstes Gesprächsthema ist, aktiv zu halten. Dennoch haben wir auch in schwierigen Zeiten neue, spannende Wege gefunden, weiter aktiv zu bleiben. Beispielsweise durch Social Media. Wir haben Livestreams gestartet, Menschen informiert und kreative Aktionen unternommen. Auch die Klimakommission von Ravensburg hat ihren Abschluss gefunden und wurde einstimmig vom Gemeinderat bestätigt.
Für das kommende Jahr erhoffe ich mir von der Politik vor allem, dass sie anfängt ihr Blickfeld zu erweitern und zu erkennen, dass die Corona-Krise nicht unser einziges Problem ist. Es ist leicht, eine der größten Krisen der Menschheit, den Klimawandel, aus dem Blick zu verlieren, da seine Folgen für uns als privilegierte Deutsche im Moment noch nicht direkt spürbar sind. Denn unfairer Weise werden uns, die Verursacher, die Auswirkungen erst viel später treffen, doch bereits jetzt leiden Menschen, wenn auch für uns nicht sichtbar, darunter.
Ich wünsche mir, dass diese Krise auch endlich als solche behandelt wird und auch Taten zu sehen sind. Denn schnelles und effektives Handeln ist, wie uns diese Zeit gezeigt hat, möglich, sofern man es auch will. Gerade jetzt muss man sich überlegen, ob Regeln wie der eingeschränkte Flug- und Reiseverkehr wirklich alles Einschränkungen sind oder ob man viele dieser Dinge nicht sogar noch weiter ausbauen und beibehalten könnte. Unser Ziel darf jetzt nicht sein, die Pandemie zu überwinden und danach wie bisher weiter zu machen. Unser Ziel muss sein, neue Konzepte zu entwickeln und Altes neu zu denken. Das wünsche ich mir für 2021.
Statements im Überblick:
"Wir müssen die Chance ergreifen"
"Dabei darf es nicht bleiben"
"Merken, was wirklich zählt im Leben"
„Und sei es nur Regen im April“
"Aus dem größten Mist wird der beste Dünger"
"Solidarität als zentralen Kitt"
"Umkehr ist immer noch möglich"
"Die Bevölkerung hat verstanden"
"Corona-Krise nicht mit Klimawandel gleichsetzen"
"Sie ist eine große Demutserfahrung"
"Solidarität heißt Abstand halten!"
"Ein Jahrzehnt verschlafen"
"Einen positiven Lerneffekt mitnehmen"
"So viele Zitzen hat keine Kuh"
"Wir werden als Gesellschaft unsere Prioritäten neu setzen"
"Wir brauchen verlässliche Partner in der Politik"
"Muss ich soviel fliegen, rumfahren, konsumieren?"
"Raum für grundlegende Veränderungen"
"Ohne Wirtschaft ist alles nichts"
"By desaster, not by design"
"Das wünsche ich mir für 2021"
Winfried Kretschmann,
Ministerpräsident Baden-Württemberg, Bündnis 90/Die Grünen
"Wir müssen die Chance ergreifen"
 "Die Corona-Pandemie hat unvergleichlich tief in unseren Alltag eingegriffen. Ich würde allen raten, danach nicht einfach wieder zur Tagesordnung überzugehen. Wir sollten uns überlegen: Wo können wir in unserer globalisierten Welt unser Handeln neu justieren? Den Virus werden wir spätestens mit einem Impfstoff besiegen können. Doch gegen die Erderwärmung gibt es keine Impfung. Die Klimakrise wird bleiben. Wenn die Temperaturen um mehr als zwei Grad ansteigen, dann hätte das noch schlimmere Folgen als die Seuche. Ganze Länder würden verschwinden, es gäbe Ernteausfälle in unbekanntem Ausmaß und abertausende Hitzetote. Bei der Belebung der Wirtschaft müssen wir deswegen den Klimaschutz in den Blick nehmen. Wir müssen die Chance ergreifen, die Wirtschaft nach der Corona-Krise klug, nachhaltig und klimaverträglich neu zu strukturieren. Unser großes Ziel muss es sein, das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Wenn es uns weiterhin gelingt, Ökologie und Ökonomie miteinander zu verbinden, dann machen wir unsere heimischen Unternehmen zur Nummer eins bei Ressourceneffizienz und Umwelttechnologien. So kann Nachhaltigkeit zum echten Markenzeichen unseres Landes werden."
"Die Corona-Pandemie hat unvergleichlich tief in unseren Alltag eingegriffen. Ich würde allen raten, danach nicht einfach wieder zur Tagesordnung überzugehen. Wir sollten uns überlegen: Wo können wir in unserer globalisierten Welt unser Handeln neu justieren? Den Virus werden wir spätestens mit einem Impfstoff besiegen können. Doch gegen die Erderwärmung gibt es keine Impfung. Die Klimakrise wird bleiben. Wenn die Temperaturen um mehr als zwei Grad ansteigen, dann hätte das noch schlimmere Folgen als die Seuche. Ganze Länder würden verschwinden, es gäbe Ernteausfälle in unbekanntem Ausmaß und abertausende Hitzetote. Bei der Belebung der Wirtschaft müssen wir deswegen den Klimaschutz in den Blick nehmen. Wir müssen die Chance ergreifen, die Wirtschaft nach der Corona-Krise klug, nachhaltig und klimaverträglich neu zu strukturieren. Unser großes Ziel muss es sein, das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Wenn es uns weiterhin gelingt, Ökologie und Ökonomie miteinander zu verbinden, dann machen wir unsere heimischen Unternehmen zur Nummer eins bei Ressourceneffizienz und Umwelttechnologien. So kann Nachhaltigkeit zum echten Markenzeichen unseres Landes werden."
Manfred Lucha,
Minister für Soziales und Integration, Bündnis 90/Die Grünen
"Dabei darf es nicht bleiben"
 "Was bleibt nach Corona? Zuallererst das Staunen darüber und die Dankbarkeit dafür, wie flexibel, verantwortungsbewusst, diszipliniert, konstruktiv, solidarisch und originell die Menschen überall im Land auf eine Herausforderung reagieren, mit der kein Lebender je konfrontiert war. Nachbarn im Quartier helfen einander bei den täglichen Erledigungen des Alltags. Unternehmen stellen ihre Produktion um. Der innerstädtische Handel entwickelt spontan neue Online-Angebote. Es gibt unzählige weitere, positive Beispiele. Doch wir sind noch längst nicht 'nach Corona'. Wir sehen jetzt erste Erfolge. Die Ansteckungszahlen verlangsamen sich. Denn die Menschen im Land ziehen mit, halten sich an die Regeln. Meine große Bitte ist, weiter so diszipliniert zu bleiben. Auch wenn es schwerfällt. Dann können wir diese Krise in den Griff bekommen. Erste Lockerungen sind bereits beschlossen.
"Was bleibt nach Corona? Zuallererst das Staunen darüber und die Dankbarkeit dafür, wie flexibel, verantwortungsbewusst, diszipliniert, konstruktiv, solidarisch und originell die Menschen überall im Land auf eine Herausforderung reagieren, mit der kein Lebender je konfrontiert war. Nachbarn im Quartier helfen einander bei den täglichen Erledigungen des Alltags. Unternehmen stellen ihre Produktion um. Der innerstädtische Handel entwickelt spontan neue Online-Angebote. Es gibt unzählige weitere, positive Beispiele. Doch wir sind noch längst nicht 'nach Corona'. Wir sehen jetzt erste Erfolge. Die Ansteckungszahlen verlangsamen sich. Denn die Menschen im Land ziehen mit, halten sich an die Regeln. Meine große Bitte ist, weiter so diszipliniert zu bleiben. Auch wenn es schwerfällt. Dann können wir diese Krise in den Griff bekommen. Erste Lockerungen sind bereits beschlossen.
Was müssen wir ändern? Ich will nur ein großes Thema nennen, für den ich mich als Sozial- und Gesundheitsminister von Anfang an eingesetzt habe: Menschen, die in der Pflege arbeiten, erfahren gerade viel Bewunderung, Solidarität und Dankbarkeit. Zu Recht. Doch dabei darf es nicht bleiben. Schon vor Corona habe ich mit vielen anderen für eine grundlegende Reform der Pflegeversicherung bis hin zu zahlreichen Maßnahmen der Stärkung und Professionalisierung der Pflegeberufe gekämpft. Jetzt gibt es eine echte Chance, dass wir sehr schnell über Parteigrenzen hinweg große und substanzielle Fortschritte bei diesen Fragen erzielen."
Martin Gerster,
Bundestagsabgeordneter, SPD, Biberach
"Merken, was wirklich zählt im Leben"
 "Die Corona-Pandemie hat uns wie nie seit Ende des Zweiten Weltkriegs ebenso aufgerüttelt wie ruhiggestellt. Viele der gewohnten Strukturen und Orientierungslinien sind vorübergehend weggefallen und ich bin überzeugt, dass einige sich als nicht mehr geeignet erweisen werden, unsere Zukunft zu gestalten. Denn eine noch einschneidendere Entwicklung, die uns nicht individuell sofort tödlich bedroht, ist schon deutlich angelaufen – die Erderhitzung. Menschenverursachte Weltklimaveränderungen sind derzeit vielleicht beim austrocknenden Garten in immer heißeren Sommern direkt zu spüren. Nicht sinnlich erfahrbar sind dagegen die datenbasierten Zukunftsprognosen von Wissenschaftlern, die auch für Deutschland in naher Zukunft dauerhaft Flächen unter dem Meeresspiegel vorhersagen, wo heute noch Küstengebiete und Uferbereiche zu sehen sind. Spürbar für uns ist die momentane relative Stille auf den Straßen und Plätzen, die leeren Autobahnen und Restaurants.
"Die Corona-Pandemie hat uns wie nie seit Ende des Zweiten Weltkriegs ebenso aufgerüttelt wie ruhiggestellt. Viele der gewohnten Strukturen und Orientierungslinien sind vorübergehend weggefallen und ich bin überzeugt, dass einige sich als nicht mehr geeignet erweisen werden, unsere Zukunft zu gestalten. Denn eine noch einschneidendere Entwicklung, die uns nicht individuell sofort tödlich bedroht, ist schon deutlich angelaufen – die Erderhitzung. Menschenverursachte Weltklimaveränderungen sind derzeit vielleicht beim austrocknenden Garten in immer heißeren Sommern direkt zu spüren. Nicht sinnlich erfahrbar sind dagegen die datenbasierten Zukunftsprognosen von Wissenschaftlern, die auch für Deutschland in naher Zukunft dauerhaft Flächen unter dem Meeresspiegel vorhersagen, wo heute noch Küstengebiete und Uferbereiche zu sehen sind. Spürbar für uns ist die momentane relative Stille auf den Straßen und Plätzen, die leeren Autobahnen und Restaurants.
Der Appell zu Verhaltensänderungen wirkt, wie sich in den zurückgehenden Neuinfektionszahlen zeigt, und hat zur Folge, dass wir vermehrt den zwischenmenschlichen Kontakt zu schätzen wissen, wieder merken, was wirklich zählt im Leben: die gegenseitige Zuwendung, das Füreinander-da-sein, das Zurückstellen egoistischen Gewinnstrebens auf Kosten anderer. Diese Erfahrung nachhaltig wirksam werden zu lassen, kann Kreativimpuls für neue Strukturen in Richtung einer gerechteren, sozialeren und Planeten schützenderen Wirtschaftsweise sein. Dafür setze ich mich ein".
Roland Roth,
Wetterwarte Süd
"Und sei es nur Regen im April"
 „Kaum zu glauben, was in Corona-Zeiten alles möglich ist. Plötzlich lassen sich die große und kleine Politik und die Geschäfts- und Handelsbeziehungen ohne Flugreisen per Telefon oder Videokonferenz managen. Vor wenigen Wochen noch unvorstellbar. Wenn man bedenkt, was für ein Tross an Politikern, Ministern, Dolmetschern und Mitarbeitern, Wissenschaftlern, Fachleuten und sonstigen wichtigen Personen regelmäßig um die ganze Welt geflogen ist, um Klimakonferenzen abzuhalten, bei denen lediglich viel heiße Luft produziert wurde. Plötzlich verfügt unser Staat über Unsummen an Finanzmitteln, die für den nachhaltigen Klimaschutz und die dringend nötige Verkehrswende noch nicht mal im Ansatz vorhanden waren. Und plötzlich sind die Menschen bereit, auf die Wissenschaftler und deren Empfehlungen zu hören.
„Kaum zu glauben, was in Corona-Zeiten alles möglich ist. Plötzlich lassen sich die große und kleine Politik und die Geschäfts- und Handelsbeziehungen ohne Flugreisen per Telefon oder Videokonferenz managen. Vor wenigen Wochen noch unvorstellbar. Wenn man bedenkt, was für ein Tross an Politikern, Ministern, Dolmetschern und Mitarbeitern, Wissenschaftlern, Fachleuten und sonstigen wichtigen Personen regelmäßig um die ganze Welt geflogen ist, um Klimakonferenzen abzuhalten, bei denen lediglich viel heiße Luft produziert wurde. Plötzlich verfügt unser Staat über Unsummen an Finanzmitteln, die für den nachhaltigen Klimaschutz und die dringend nötige Verkehrswende noch nicht mal im Ansatz vorhanden waren. Und plötzlich sind die Menschen bereit, auf die Wissenschaftler und deren Empfehlungen zu hören.
Bleibt nur zu hoffen, dass dies auch nach 'Corona' noch so sein wird und sich Politik und Gesellschaft den anderen drängenden Probleme endlich ernsthaft und konsequent annehmen werden. Ich wünschte mir eine ähnliche Entschlossenheit beim Klimaschutz, natürlich mit anderen Mitteln.
Der Klimawandel ist eine schleichende Gefahr, deren Tragweite offensichtlich von vielen nach wie vor nicht erkannt wird. Im 'Jahrhundertsommer 2003' starben der 'Rhein-Schiene' (Benelux-Staaten, Ostfrankreich und Westdeutschland) entlang mehr als 50.000 Menschen aufgrund der exorbitanten Hitze, wie bei Corona vorwiegend Ältere. Mit dem Jahr 2019 ging die wärmste Dekade der Menschheitsgeschichte zu Ende. Viele Menschen sind auf der Flucht, weil in ihrer angestammten Heimat ein Leben durch die veränderten Klimabedingungen nicht mehr möglich ist. Wasser ist besonders in semiariden Gebieten ein kostbares Gut, doch es wird immer mehr zum Anlass für kriegerische Auseinandersetzungen im Überlebenskampf. Es geht längst nicht mehr nur um die für alle sichtbaren Wetterextreme wie Sturm, Dürre, Überflutungen, Hagel, verheerende Spätfröste u.v.m., die nachweisbar verbreiteter, stärker und folgenschwerer auftreten als früher, es geht um eine grundlegende Änderung der klimatischen Verhältnisse auf der Erde, um die Verschiebung ganzer Klimazonen. Der Klimawandel lässt grüßen, selbst die, welche den Ruf nicht hören wollen.
Aber kann ja sein, dass uns die Corona-Pandemie nachdenklicher gemacht hat und offener für Veränderungen unserer Lebensweise, die keineswegs von Nachteil sein müssen.
Vielleicht bleibt da sogar bei manchem aufgebrezelten 'Dumm-Püppi', das ihren Sinn bislang in inhaltsleeren Events, im Shoppen, Posen und Influenzen suchte und bei einigen der 'Macho-Männer', deren Selbstwertgefühl von der PS-Stärke ihrer Vehikel und dem sinnleeren Gasgeben abhängt, die Erkenntnis, dass es Wichtigeres gibt und sei es nur Regen im April.
... und vielleicht sieht die/der eine oder andere auch ein, dass es völlig unsinnig ist, seine Kinder mit einem PS-starken, protzigen Geländewagen selbst bei schönstem Wetter vor die Eingangstüre der Schule zu fahren und nachmittags die süßen Kleinen wieder abzuholen.
... und vielleicht erkennt ja so manche/mancher, dass es nicht immer des neuesten Smartphones bedarf und man auf viel materiellen Schrott, den man sich Monat für Monat zulegt, getrost verzichten kann. Und dies ohne Einbußen für die vermeintliche Lebensqualität. Ganz im Gegenteil!
... und vielleicht schaffen wir es ja, als eines der allerletzten Länder dieser Erde endlich ein generelles Tempo-Limit auf unsren Autobahnen einzuführen. Ein Anachronismus, der in Zeiten des Klimawandels längst überholt ist.
Aber ich befürchte, es geht danach genauso gedankenlos weiter, und wir geben sogar noch 'Vollgas', um das Versäumte auf- und nachzuholen. Anstatt effiziente Nachhaltigkeit Kommerz bis zum Gehtnichtmehr und grenzenloser Wachstumswahn, gemäß dem Motto von Media Markt 'Hauptsache ihr habt Spaß'“.
Heike Sauer,
Kabarettistin, Ulm
"Aus dem größten Mist wird der beste Dünger"
 "Corona heißt übersetzt Krone. Und das Ding setzt grad echt dem Fass die Krone auf. Aber vielleicht war dieses Fass auch viel zu voll und eh schon am Überlaufen vor lauter schneller, höher, weiter und dem Streben nach Zielen, die zur Zeit gar nicht mehr wichtig sind. Dafür rücken jetzt Dinge in den Mittelpunkt, die früher selbstverständlich waren wie zum Beispiel Gesundheit. Kleinigkeiten wie ein persönliches Telefonat zum gegenseitigen Mutmachen werden zu Großartigkeiten. Ebenso ein Lächeln, ein Dankeschön, gegenseitige Wertschätzung, Rücksichtnahme oder Respekt – auch gegenüber unserem Planeten. Alles kommt gerade ans Licht: Das Tier im Menschen (Klopapier!), aber genauso der Herzensmensch. Es geht wieder ums Wesen-tliche. Das Ranking meiner Werteskala hat sich verändert. Mir wird bewusst, wie wichtig mir das unterstützende Miteinander ist. Ich werde das alles aufschreiben, damit ich es nicht vergesse, wenn alles wieder losgeht.
"Corona heißt übersetzt Krone. Und das Ding setzt grad echt dem Fass die Krone auf. Aber vielleicht war dieses Fass auch viel zu voll und eh schon am Überlaufen vor lauter schneller, höher, weiter und dem Streben nach Zielen, die zur Zeit gar nicht mehr wichtig sind. Dafür rücken jetzt Dinge in den Mittelpunkt, die früher selbstverständlich waren wie zum Beispiel Gesundheit. Kleinigkeiten wie ein persönliches Telefonat zum gegenseitigen Mutmachen werden zu Großartigkeiten. Ebenso ein Lächeln, ein Dankeschön, gegenseitige Wertschätzung, Rücksichtnahme oder Respekt – auch gegenüber unserem Planeten. Alles kommt gerade ans Licht: Das Tier im Menschen (Klopapier!), aber genauso der Herzensmensch. Es geht wieder ums Wesen-tliche. Das Ranking meiner Werteskala hat sich verändert. Mir wird bewusst, wie wichtig mir das unterstützende Miteinander ist. Ich werde das alles aufschreiben, damit ich es nicht vergesse, wenn alles wieder losgeht.
Ich werde es aufschreiben, damit ich nicht genau so weitermache, wie ich aufgehört habe. Eben nicht als Krone der Schöpfung, das Beste für mich rausziehend, sondern mit der Frage: Was habe ich zu geben? Was kann ich beitragen? Es fängt bei mir an. Wenn ich mich verändere, kann sich auch im Großen was verändern. Und wir sehen gerade: Es kann sich tatsächlich alles von heute auf morgen ändern. Ich kann mein Ändern leben. Und ich wette mit Ihnen, es kommt etwas Besseres nach, weil aus dem größten Mist der beste Dünger wird. Irgendwie, irgendwo, irgendwann geht es weiter. Das Wann liegt nicht in meiner Hand, aber das Wie."
Prof. Wolfgang Ertel,
Leiter des Instituts für künstliche Intelligenz, Hochschule Ravensburg-Weingarten
„Politik kann mutig handeln“
 "Als Hochschullehrer und Forscher kommuniziere ich mit Studenten und mit anderen Forschern derzeit nur noch über Videokonferenzen. Wir haben von heute auf morgen gelernt, damit virtuos umzugehen. Das hat große Vorteile. Zum Beispiel hatte ich heute ein virtuelles Projekttreffen, bei dem alle Beteligten sich eine Dienstreise sparen konnten. Und ich freue mich schon darauf, im Juni die ICML-Konferenz (International Conference on Machine Learning) ganz bequem virtuell besuchen zu können. Das geht nicht nur mir so. Auch viele Firmen profitieren diesbezüglich von diesem Experiment.
"Als Hochschullehrer und Forscher kommuniziere ich mit Studenten und mit anderen Forschern derzeit nur noch über Videokonferenzen. Wir haben von heute auf morgen gelernt, damit virtuos umzugehen. Das hat große Vorteile. Zum Beispiel hatte ich heute ein virtuelles Projekttreffen, bei dem alle Beteligten sich eine Dienstreise sparen konnten. Und ich freue mich schon darauf, im Juni die ICML-Konferenz (International Conference on Machine Learning) ganz bequem virtuell besuchen zu können. Das geht nicht nur mir so. Auch viele Firmen profitieren diesbezüglich von diesem Experiment.
Die Videokonferenzen bieten uns interessante Möglichkeiten und sie schützen die Umwelt, weil wir viele Reisen einsparen. Was mir nicht so gut gefällt, sind Vorlesungen und Diskussionen mit vielen Studenten online. Hier fehlt mir der Gesichtskontakt, denn an den Gesichtern kann ich genau erkennen, ob ich verstanden werde.
Eine weitere Chance sehe ich beim Thema Home Office. Etwa die Hälfte aller Pendlerfahrten ist vermeidbar, wenn wir diese tolle Möglichkeit zum Beispeil für zwei bis drei Tage pro Woche nutzen. Ich bin optimistisch, dass viele Büroarbeiter dies auch nach Corona noch nutzen werden, denn neben dem Umweltschutz ist das Arbeiten zu Hause für viele einfach bequem und es spart Zeit.
Die wichtigste Lehre für mich ist aber die, dass unsere Politik mutig handeln kann, um eine Katastrophe zu verhindern. Das zeigt sie momentan sehr schön in der Corona-Pandemie. Der Klimawandel wird unsere Kinder in eine viel dramatischere Katastrophe führen. Daher fordere ich von allen Politikern auf allen Ebenen - kommunal, in Stuttgart sowie in Berlin - endlich auch beim Umweltschutz so konsequent zu handeln."
Beate und Uli Zimmermann,
Bergbrauerei, Ehingen
"Regionale Wirtschaftskreisläufe stärken"
 "Wie viele Menschen sorgen wir uns um die Gesundheit unserer Lieben und unserer Mitarbeiter und blicken auf die wirtschaftliche Zukunft. Die gestiegenen Flaschenbierumsätze können den Wegfall des Fassbieres nicht ausgleichen. Gastronomie und so auch unsere BrauereiWirtschaft sind geschlossen. Nachdem wir Überstunden und Urlaub abgebaut haben, sind einige unserer Mitarbeiter in Kurzarbeit. In der über 550-jährigen Geschichte unseres Hauses hat es noch nie Kurzarbeit gegeben. Es hat sicher schwere Zeiten gegeben, die man im Miteinander gelöst hat. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen sich jetzt sehr flexibel, der jeweiligen Situation angepasst, ein, und die Brauerei stockt das Kurzarbeitergeld auf. So wollen wir es für alle erträglich machen. Die schönen Begegnungen, das miteinander Feiern bei Kreismusikfesten, Schützenfest und dem Ulrichsfest, werden wir vermissen. Aber die Coronakrise wird die Existenz unserer Brauerei nicht gefährden.
"Wie viele Menschen sorgen wir uns um die Gesundheit unserer Lieben und unserer Mitarbeiter und blicken auf die wirtschaftliche Zukunft. Die gestiegenen Flaschenbierumsätze können den Wegfall des Fassbieres nicht ausgleichen. Gastronomie und so auch unsere BrauereiWirtschaft sind geschlossen. Nachdem wir Überstunden und Urlaub abgebaut haben, sind einige unserer Mitarbeiter in Kurzarbeit. In der über 550-jährigen Geschichte unseres Hauses hat es noch nie Kurzarbeit gegeben. Es hat sicher schwere Zeiten gegeben, die man im Miteinander gelöst hat. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen sich jetzt sehr flexibel, der jeweiligen Situation angepasst, ein, und die Brauerei stockt das Kurzarbeitergeld auf. So wollen wir es für alle erträglich machen. Die schönen Begegnungen, das miteinander Feiern bei Kreismusikfesten, Schützenfest und dem Ulrichsfest, werden wir vermissen. Aber die Coronakrise wird die Existenz unserer Brauerei nicht gefährden.
Ich wünsche mir, dass wir aus der Coronakrise lernen. Unser Wohlstand basiert auch auf den verlängerten Werkbänken, die wir in aller Welt haben. Bekommen die Menschen an diesen fernen Werkbänken einen gerechten Lohn? Ich wünsche mir, dass wir regionale Wirtschaftskreisläufe stärken, dass wir nicht nur von anderen einfordern, gerechte Preise zu bezahlen, sondern dass wir dies selber tun. Ich wünsche mir, dass wir daran arbeiten die Ursachen abzumildern, die Menschen veranlassen, ihre Heimat zu verlassen. Ich wünsche mir, dass wir Europa stärken, indem wir von unserem Vorteil als Exportweltmeister anderen Ländern Europas etwas abgeben.
Vieles soll so bleiben, weil es gut ist: Das menschliche Miteinander, die Fürsorge untereinander, die Achtung vor Mensch und Natur. Zusammenkommen im kleinen Kreis – zu einem Schwätzle über die Hecke werden uns Freude machen – ein Fläschle Bier, das „Zum Wohl“ ist eine schöne Geste und ein Beitrag zur Lebensfreude. In diesem Sinnen wünsche ich den Leserinnen und Lesern einen schönen Sommer – bleiben Sie gesund!"
Martina Magg-Riedesser,
Bäuerin und stellv. Landesvors. „Land schafft Verbindung“, Achstetten
„Zeichen für einen Sinneswandel“
 "Seit Monaten gibt es kein anderes Thema mehr in den Medien – Covid 19 ist allgegenwärtig!
"Seit Monaten gibt es kein anderes Thema mehr in den Medien – Covid 19 ist allgegenwärtig!
Das Coronavirus hat unser Le“ben verändert – die Angst vor Ansteckung hat uns inzwischen zur Maskenpflicht verdammt. Welche Auswirkungen hat das Virus auf landwirtschaftliche Betriebe?
Wichtig ist es mir in diesem Zusammenhang klarzustellen, dass es bislang keine Hinweise gibt, dass Nutztiere Überträger der Viruserkrankung sind. Bisher gibt es bei uns auf dem Hof keine Einschränkungen im Betriebsablauf. Auch von Engpässen im Einkauf wie z.B. Futter oder Saatgut sind wir verschont geblieben. Jedoch zeichnet sich vor allem im Schweinebereich eine beginnende Sättigung des Marktes ab, was bisher bereits zu einem Preisverfall von 40 Cent (ca. 25%) pro Kilogramm Fleisch geführt hat – bei weiterhin fallender Tendenz. Auch der Milchpreis ist seit Monaten unter Druck: eine zu hohe Produktion, ein zu geringer Absatz und nun kommen auch noch Lieferschwierigkeiten beim Verpackungsmaterial dazu. Preiseinbrüche bei Milch und Fleisch waren die Folge. Die Gründe für den jeweiligen Absatzrückgang lassen sich vor allem durch fehlenden Außer-Haus-Verzehr in Gastronomie, Mensa und Kantinen sowie den stark eingeschränkten Export erklären. Der daraus entstehende Preisverfall ist sehr schmerzhaft für uns, die Erzeuger hochwertiger regionaler Lebensmittel, einem systemrelevanten Beruf. In den Sonderkulturbetrieben wie z.B. Spargel, Erdbeeren, Obst- und Weinbau, kommt zum Absatzrückgang auch noch ein Mangel an Saisonarbeitskräften, was sie ebenfalls sehr hart trifft. Nur unter deutlich erschwerten Bedingungen konnten Arbeitskräfte einreisen und nur in ungenügender Zahl. Dank des Einsatzes von vielen regionalen Helfern konnten diese Engpässe wenigsten teilweise kompensiert werden, jedoch sind insgesamt Ernteausfälle zu erwarten.
Ich hoffe und wünsche mir, dass die teilweise leeren Regale im Supermarkt langfristige Auswirkungen auf das Kaufverhalten und die Wertschätzung gegenüber der Landwirtschaft haben wird! Die Krise hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass hochwertige Lebensmittel in ausreichenden Mengen regional produziert werden. Aber wir Bauern benötigen für eine langfristig gesicherte Versorgung auch einen auskömmlichen Preis für die Lebensmittel sowie eine gewisse Wertschätzung für unsere Arbeit. Hofläden und Marktstände erfreuen sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit – eine erfreuliche Entwicklung und ein erstes Zeichen für einen Sinneswandel gegenüber der Landwirtschaft.
In Bezug auf den spürbaren Klimawandel erwarten wir von der Politik, dass sie praktikable Lösungen anbietet, anstatt uns weiterhin die Daumenschrauben anzulegen. Weitere Verordnungen und Restriktionen stellen die Landwirtschaft vor große Herausforderungen, die irgendwann nicht mehr zu bewerkstelligen sind. Nur durch ein Miteinander von Gesellschaft, Politik und Landwirtschaft lassen sich die zukünftigen Herausforderungen, allen voran der Klimawandel, bewältigen!"
Michael Pfeiffer,
ev. Schuldekan, Biberach
"Solidarität als zentralen Kitt"
 "Soll etwas nach der Corona-Pandemie bleiben? - Meine kleine Enkelin, die derzeit mit ihrem Bruder von recht gestressten Eltern in einer Drei-Zimmer-Wohnung in Köln betreut wird, würde darauf vielleicht antworten: „‚Corinna‘ – so nennt sie das Virus – soll aus dem Kindergarten wieder raus, aber Papa und Mama sollen weiter auch mit uns spielen.“ Die Krise hat – trotz allem Furchtbaren, was sie gesundheitlich, wirtschaftlich, sozial anrichtet, auch Chancen. Sie weist uns auf Wesentliches hin. Sie lehrt uns 'neues Sehen'. Wie wichtig Pflegekräfte, Verkäuferinnen, Busfahrer … sind, habe ich jedenfalls neu erfahren. Der Verzicht auf Kontakt hat mir all die Verbindungen, in denen ich zu Menschen stehe, neu bewusst gemacht. … Soll etwas von ‚Corinna‘ bleiben? Wenn wir die wesentlichen Dinge im Leben neu schätzen lernen: Gemeinschaft, Solidarität als zentralen 'Kitt' unserer Gesellschaft und in unserer Welt. Das wäre was! Ein bedingungsloses Grundeinkommen würde einige, die das hier lesen, zum Beispiel gleich sorgenfreier aussehen lassen. Von Corona lerne ich, dass die Egoisten alles kaputt machen. Das fängt bei Hamsterkäufen an. Es geht beim Überbieten und Wegkaufen von Atemmasken durch reiche Länder weiter. Und es endet leider nicht in den überfüllten Flüchtlingslagern. Corona zeigt mir in meiner unmittelbaren Umgebung und in der weltweiten Vernetzung: Nur Solidarität bringt uns weiter. 'Die Pandemie überwinden wir nur weltweit oder gar nicht!', sagte Bundesentwicklungsminister Müller. Das gilt genauso für die Klimakrise. Die Fotos Corona bedingter smogfreier chinesischer Städte könnten uns ermutigen, Widerstand gegen die rein gewinnorientierte Ausbeutung und Schädigung der Natur zu leisten. So wie ‚Corinna‘ zu unser aller Angelegenheit geworden ist, muss auch die Klimakrise zu unser aller Sache werden. Oder werden wir eine gesunde Umwelt erst dann schätzen, wenn wir sie nicht mehr haben?"
"Soll etwas nach der Corona-Pandemie bleiben? - Meine kleine Enkelin, die derzeit mit ihrem Bruder von recht gestressten Eltern in einer Drei-Zimmer-Wohnung in Köln betreut wird, würde darauf vielleicht antworten: „‚Corinna‘ – so nennt sie das Virus – soll aus dem Kindergarten wieder raus, aber Papa und Mama sollen weiter auch mit uns spielen.“ Die Krise hat – trotz allem Furchtbaren, was sie gesundheitlich, wirtschaftlich, sozial anrichtet, auch Chancen. Sie weist uns auf Wesentliches hin. Sie lehrt uns 'neues Sehen'. Wie wichtig Pflegekräfte, Verkäuferinnen, Busfahrer … sind, habe ich jedenfalls neu erfahren. Der Verzicht auf Kontakt hat mir all die Verbindungen, in denen ich zu Menschen stehe, neu bewusst gemacht. … Soll etwas von ‚Corinna‘ bleiben? Wenn wir die wesentlichen Dinge im Leben neu schätzen lernen: Gemeinschaft, Solidarität als zentralen 'Kitt' unserer Gesellschaft und in unserer Welt. Das wäre was! Ein bedingungsloses Grundeinkommen würde einige, die das hier lesen, zum Beispiel gleich sorgenfreier aussehen lassen. Von Corona lerne ich, dass die Egoisten alles kaputt machen. Das fängt bei Hamsterkäufen an. Es geht beim Überbieten und Wegkaufen von Atemmasken durch reiche Länder weiter. Und es endet leider nicht in den überfüllten Flüchtlingslagern. Corona zeigt mir in meiner unmittelbaren Umgebung und in der weltweiten Vernetzung: Nur Solidarität bringt uns weiter. 'Die Pandemie überwinden wir nur weltweit oder gar nicht!', sagte Bundesentwicklungsminister Müller. Das gilt genauso für die Klimakrise. Die Fotos Corona bedingter smogfreier chinesischer Städte könnten uns ermutigen, Widerstand gegen die rein gewinnorientierte Ausbeutung und Schädigung der Natur zu leisten. So wie ‚Corinna‘ zu unser aller Angelegenheit geworden ist, muss auch die Klimakrise zu unser aller Sache werden. Oder werden wir eine gesunde Umwelt erst dann schätzen, wenn wir sie nicht mehr haben?"
Ekkehard Schmid,
kath. Dekan, Weingarten
"Umkehr ist immer noch möglich"
 "Bei Rilke heißt es: 'Überstehen ist alles.' Aber jede Krise fordert zu mehr. Wo es lebensgefährlich wird, beginnen wir neu und anders zu leben – hoffentlich. Denn das Trägheitsmoment ist groß und die Vergesslichkeit auch. Und doch: Wie beeindruckend kommt derzeit die (Mit-)Menschlichkeit zum Leuchten! Wir spüren: Nicht Dinge sondern Menschen und Beziehungen sind lebensnotwendig und lebenswert. Gut, dass Kontakte längst digital möglich sind, aber dass dieses Medium seine Grenzen hat, wird in Tagen wie diesen ebenso klar. Komisch allerdings ist, dass es ein Betretungsverbot braucht, um zu spüren, dass einen Sterbenden nichts so sehr hält wie eine haltende Hand und dass der einsame Tod genauso grausam sein kann wie ein medizinisch qualvoller. Das wäre immerhin eine Erkenntnis aus dieser Krise. Eine andere könnte sein, dass wir vieles von dem, was wir meinten zu brauchen, nicht brauchen. Ich hoffe, dass wir in diesen Wochen unsere Wohnungen nicht nur entrümpelt haben, damit wieder neuer Müll Platz hat. Die ökologischen Vorteile dieser Krise dürfen nicht wie ein Jojo-Effekt verspielt werden! Es ist eine Binsenweisheit, dass globale Krisen auch gemeinsam und nicht nationalistisch oder gar egoistisch à la Nudeln und Klopapier gelöst werden können. Solidarität meint nicht nur Internationalität, sondern Gerechtigkeit und damit der Blick auf die Verlierer, die Armen, und nicht nur auf die Gewinner, die Reichen. 'Und fange bei mir an' – heißt es in einem Gebet. Nur wenn ALLE damit anfangen und vor allem jene, die an den Weichen sitzen, wird etwas geschehen. Und dass Umkehr immer noch möglich ist, ist für mich ein Zeichen, dass eine Krise nie Strafe Gottes ist, sondern ein Zeichen seiner Eselsgeduld mit uns."
"Bei Rilke heißt es: 'Überstehen ist alles.' Aber jede Krise fordert zu mehr. Wo es lebensgefährlich wird, beginnen wir neu und anders zu leben – hoffentlich. Denn das Trägheitsmoment ist groß und die Vergesslichkeit auch. Und doch: Wie beeindruckend kommt derzeit die (Mit-)Menschlichkeit zum Leuchten! Wir spüren: Nicht Dinge sondern Menschen und Beziehungen sind lebensnotwendig und lebenswert. Gut, dass Kontakte längst digital möglich sind, aber dass dieses Medium seine Grenzen hat, wird in Tagen wie diesen ebenso klar. Komisch allerdings ist, dass es ein Betretungsverbot braucht, um zu spüren, dass einen Sterbenden nichts so sehr hält wie eine haltende Hand und dass der einsame Tod genauso grausam sein kann wie ein medizinisch qualvoller. Das wäre immerhin eine Erkenntnis aus dieser Krise. Eine andere könnte sein, dass wir vieles von dem, was wir meinten zu brauchen, nicht brauchen. Ich hoffe, dass wir in diesen Wochen unsere Wohnungen nicht nur entrümpelt haben, damit wieder neuer Müll Platz hat. Die ökologischen Vorteile dieser Krise dürfen nicht wie ein Jojo-Effekt verspielt werden! Es ist eine Binsenweisheit, dass globale Krisen auch gemeinsam und nicht nationalistisch oder gar egoistisch à la Nudeln und Klopapier gelöst werden können. Solidarität meint nicht nur Internationalität, sondern Gerechtigkeit und damit der Blick auf die Verlierer, die Armen, und nicht nur auf die Gewinner, die Reichen. 'Und fange bei mir an' – heißt es in einem Gebet. Nur wenn ALLE damit anfangen und vor allem jene, die an den Weichen sitzen, wird etwas geschehen. Und dass Umkehr immer noch möglich ist, ist für mich ein Zeichen, dass eine Krise nie Strafe Gottes ist, sondern ein Zeichen seiner Eselsgeduld mit uns."
Jost Einstein,
Ökologe, Bad Buchau
"Die Bevölkerung hat verstanden"
 "Wissenschaft und die Politik haben die wachsende Gefahr von Pandemien schon lange erkannt, und in vielen Staaten der Welt wurden vorausschauend Pandemiepläne erstellt. Die Pläne haben alle drei Dinge gemeinsam:
"Wissenschaft und die Politik haben die wachsende Gefahr von Pandemien schon lange erkannt, und in vielen Staaten der Welt wurden vorausschauend Pandemiepläne erstellt. Die Pläne haben alle drei Dinge gemeinsam:
1. Sie beschreiben die Problematik und die Risiken durch eine Pandemie treffend.
2. Sie zeigen Möglichkeiten der Vermeidung und Bekämpfung auf.
3. Sie wurden nie umgesetzt.
Im Angesicht der Gefahr Hunderttausender oder gar Millionen Toter durch das Corona-Virus hat die Politik in Deutschland entschlossen gehandelt. Die Maßnahmen haben das öffentliche Leben und die Wirtschaft drastisch heruntergebremst. Das war mutig, aber die Bevölkerung hat verstanden und trägt die Maßnahmen mit. Wer hätte sich noch im Februar vorstellen können, was heute normal ist!
Der Umgang mit der Corona-Krise kann uns als Vorlage für die Bewältigung der drohenden Klimakatastrophe dienen. Diese bahnt sich bereits an. Gelingt es uns nicht sehr schnell, wirksame Gegenmaßnahmen gegen die Erderwärmung zu ergreifen, werden wir in den nächsten zwanzig Jahren eine Katastrophe erleben, die Corona weit in den Schatten stellt. Es wird weltweit – vor allem im globalen Süden – zig Millionen Tote geben. Wir werden unvorstellbare Flüchtlingsströme erleben. Und wir werden in Deutschland eine viele Millionen betreffende Massenarbeitslosigkeit bekommen mit einer gravierenden Verarmung und weit reichenden Folgen für die Sozialsysteme. Denn auf fossilen Energieträgern fußende Industrien, wie die Automobil- oder die Tourismusindustrie, werden weitgehend zusammenbrechen.
Ich wünsche mir von der Politik ein entschlossenes Handeln zugunsten einer wirklich nachhaltigen Wirtschaftspolitik – jetzt, wo noch aktiv gesteuert werden kann und wir noch nicht mit dem Rücken zur Wand stehen. Und ich wünsche mir, dass wir Bürger die notwendigen Maßnahmen mittragen. Es wäre doch unverzeihlich, wenn unsere Kinder in zwanzig Jahren über uns sagen müssten: Sie haben die Problematik und die Risiken einer Klimakatastrophe treffend beschrieben, sie haben auch Klimaschutzpläne aufgestellt – sie haben diese aber nie umgesetzt."
Axel Müller,
Bundestagsabgeordneter, CDU, Weingarten
"Corona-Krise nicht mit Klimawandel gleichsetzen"
 „Wir sollten uns hüten, Corona-Krise und Klimawandel gleichzusetzen. Innerhalb kürzester Zeit sind an den Folgen der Viruserkrankung zehntausende Menschen verstorben, während die Erderwärmung uns weiterhin Spielräume für vernünftige Entscheidungen lässt. Insofern gilt: Was vor Corona in der Klimapolitik richtig war, ist auch danach richtig. Und da sind wir in Deutschland bereits auf einem guten Weg: Mit dem Klimapaket ist die Große Koalition trotz aller Kritik schon in Vorleistung gegangen. Der Ausstieg aus Kernenergie und Kohle ist eingeleitet – keine andere Industrienation hat einen solch dramatischen Wandel bislang versucht. Aber es gibt auch eine spannende Parallele: Sowohl das Coronavirus als auch CO2-Emmisionen interessieren sich nicht für nationale Grenzen. Insofern bleibt es richtig, dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als ein Kernthema den Wandel zu einer ökologischen Wirtschaft (European Green Deal) definiert hat. Wenn die UN (Vereinte Nationen) jedoch davon ausgehen, dass sich die Corona-Krise und ihre Folgen zur weltweit größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg entwickeln und zwangsläufig in eine Rezession führen wird, dann werden wir auch den Herausforderungen der Klima- und Umweltpolitik nun erst recht pragmatisch und wirtschaftlich vernünftig begegnen müssen. Das war meine Überzeugung in der Vergangenheit und bleibt das klare Ziel für die Zukunft."
„Wir sollten uns hüten, Corona-Krise und Klimawandel gleichzusetzen. Innerhalb kürzester Zeit sind an den Folgen der Viruserkrankung zehntausende Menschen verstorben, während die Erderwärmung uns weiterhin Spielräume für vernünftige Entscheidungen lässt. Insofern gilt: Was vor Corona in der Klimapolitik richtig war, ist auch danach richtig. Und da sind wir in Deutschland bereits auf einem guten Weg: Mit dem Klimapaket ist die Große Koalition trotz aller Kritik schon in Vorleistung gegangen. Der Ausstieg aus Kernenergie und Kohle ist eingeleitet – keine andere Industrienation hat einen solch dramatischen Wandel bislang versucht. Aber es gibt auch eine spannende Parallele: Sowohl das Coronavirus als auch CO2-Emmisionen interessieren sich nicht für nationale Grenzen. Insofern bleibt es richtig, dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als ein Kernthema den Wandel zu einer ökologischen Wirtschaft (European Green Deal) definiert hat. Wenn die UN (Vereinte Nationen) jedoch davon ausgehen, dass sich die Corona-Krise und ihre Folgen zur weltweit größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg entwickeln und zwangsläufig in eine Rezession führen wird, dann werden wir auch den Herausforderungen der Klima- und Umweltpolitik nun erst recht pragmatisch und wirtschaftlich vernünftig begegnen müssen. Das war meine Überzeugung in der Vergangenheit und bleibt das klare Ziel für die Zukunft."
Norbert Zeidler,
Oberbürgermeister Biberach
"Sie ist eine große Demutserfahrung"
 Was wird sich durch die Corona-Krise mit Blick auf die Zukunft ändern?
Was wird sich durch die Corona-Krise mit Blick auf die Zukunft ändern?
Einerseits hoffe ich sehr, dass sich so wenig wie möglich ändern wird: dass unsere Wirtschaft diese Krise einigermaßen glimpflich übersteht, dass unsere lebendigen und attraktiven Innenstädte nicht zu Problemzonen werden, weil eine Insolvenzwelle über Einzelhandel und Gastronomie rollt. Ich hoffe, dass wir am Ende dieser Krise schnell die gerade so nötige soziale Distanz wieder abbauen können, dass unser Umgang untereinander nicht nachhaltig angeknackst und von einer gewissen Angst geprägt sein wird.
Andererseits können wir aus dieser Krise vielleicht auch manches nachhaltig lernen. Sie ist eine große Demutserfahrung für eine ganze Generation in unserem Land. Allen Krisen, die wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten erleben mussten, konnten wir aus dem Weg gehen – oder sie wurden andernorts für uns gelöst. Corona ist anders, denn: Corona betrifft uns alle unmittelbar. Positiver Nebeneffekt: Alle müssen sich mit der momentanen Situation beschäftigen und sich mit Politik auseinandersetzen.
Einige Erfahrungen, die wir in dieser Krise machen, werden uns hoffentlich auch in der Zeit 'nach Corona' als Blaupause dienen: Die Wertschätzung für Pflegeberufe und Supermarktkassiererinnen zum Beispiel; oder die blitzartige Digitalisierung vieler Sitzungen und Meetings, die plötzlich möglich ist und nebenbei zu einem Rückgang von Dienstfahrten führt; schließlich auch die Eindämmung der Sucht nach Event, Party und dem spontanen Wochenendtrip per Flugzeug: Wir müssen – und dürfen! – gerade lernen, dass niemand irgendwo etwas verpasst. Wenn wir diese Haltungen aus dieser Krise mitnehmen würden, dann hätte sie, bei allem Leid und allem Schaden, den sie mit sich gebracht hat, zumindest noch ein wenig Gutes gehabt.
Bärbel Mauch,
Regionsgeschäftsführerin des DGB Südwürttemberg, Ulm
"Solidarität heißt Abstand halten!"
 "Zum ersten Mal in der Geschichte des Deutschen Gewerkschaftsbundes findet der 1. Mai nicht auf der Straße statt. Das ist für uns Gewerkschaften ein komisches Gefühl, denn zum 1. Mai gehört das Zusammensein, die politischen Botschaften und natürlich das Feiern. Normalerweise stecken wir Ende April in den letzten Vorbereitungen für unsere Kundgebungen. Jetzt drehen wir Videobotschaften und zeigen uns im World Wide Web. Unsere Botschaft lautet „Solidarität heißt Abstand halten!“
"Zum ersten Mal in der Geschichte des Deutschen Gewerkschaftsbundes findet der 1. Mai nicht auf der Straße statt. Das ist für uns Gewerkschaften ein komisches Gefühl, denn zum 1. Mai gehört das Zusammensein, die politischen Botschaften und natürlich das Feiern. Normalerweise stecken wir Ende April in den letzten Vorbereitungen für unsere Kundgebungen. Jetzt drehen wir Videobotschaften und zeigen uns im World Wide Web. Unsere Botschaft lautet „Solidarität heißt Abstand halten!“
Auch unser Arbeitsalltag hat sich geändert. Vieles spielt sich jetzt im Home Office und in Video- und Telefonkonferenzen ab. Betriebsratssitzungen, Rechtsberatungen und Tarifverhandlungen - die Corona-Krise nimmt uns vieles, was gewohnt und bewährt ist, und fordert uns damit heraus. Der Blick auf Manches verändert sich: da werden Menschen sichtbar, denen man sonst nicht viel Beachtung schenkt, heute sind sie „systemrelevant“ – Krankenschwestern, Verkäuferinnen, Reinigungspersonal. Unser Sozialstaat – oft in der Kritik und in Gefahr – zeigt, was er drauf hat. Kurzarbeiter- und Arbeitslosengeld, ärztliche Versorgung und Notfallbetreuung, davon können andere nur träumen.
Aber wir erleben auch die Einschränkung von demokratischen Grundrechten wie der Versammlungsfreiheit. Und die Verteilung der finanziellen Hilfen des Staates ist nicht automatisch gerecht. Manches ändert sich eben doch nicht. Wir Gewerkschaften lernen auch aus dieser Krise und werden diejenigen nicht vergessen, die den Laden am Laufen gehalten haben."
Benjamin Strasser
Rechtsanwalt, Bundestagsabgeordneter, FDP, Ravensburg
"Ein Jahrzehnt verschlafen"
 "Das Corona-Virus ist eine weltweite Belastungsprobe. Wenn das öffentliche und private Leben über mehrere Wochen zurückgefahren wird und Grundrechte der Menschen immens eingeschränkt werden müssen, verändert das alle Gewohnheiten. Es war beeindruckend, wie viele Menschen in den vergangenen Wochen Verantwortung nicht nur für sich, sondern auch für ihre Mitmenschen übernommen haben. Egal ob in den Berufen des Gesundheits- und Pflegesektors, der Lebensmittelversorgung oder bei ehrenamtlichen Einkäufen für Risikogruppen. Diesen Menschen gilt unser aller Dank und Respekt. Unsere Gesellschaft ist in dieser schweren Zeit ein Stück zusammengerückt. Das sollten wir uns bewahren.
"Das Corona-Virus ist eine weltweite Belastungsprobe. Wenn das öffentliche und private Leben über mehrere Wochen zurückgefahren wird und Grundrechte der Menschen immens eingeschränkt werden müssen, verändert das alle Gewohnheiten. Es war beeindruckend, wie viele Menschen in den vergangenen Wochen Verantwortung nicht nur für sich, sondern auch für ihre Mitmenschen übernommen haben. Egal ob in den Berufen des Gesundheits- und Pflegesektors, der Lebensmittelversorgung oder bei ehrenamtlichen Einkäufen für Risikogruppen. Diesen Menschen gilt unser aller Dank und Respekt. Unsere Gesellschaft ist in dieser schweren Zeit ein Stück zusammengerückt. Das sollten wir uns bewahren.
Bei Gesundheit sind wir top, Digitalisierung ist bei uns ein Flop. Home Office mit schnellem Internet im ländlichen Raum? Nahezu unmöglich. Digitale Bildung? Peinlich. Jede Schule, ja jede Lehrkraft muss sich selbst behelfen. Die einen rufen an, die anderen mailen, manche faxen und andere übermitteln Aufgaben per ruckelnder Videokonferenz. Ein unhaltbarer Zustand. Bei der Erledigung von Behördengängen ist das Bild noch trauriger. Digital geht fast nichts. Jetzt rächt sich, dass wir ein Jahrzehnt verschlafen haben. Ich hoffe, dass wir nach der Krise einen Quantensprung machen und vom Abstiegsrang zumindest wieder ans Mittelfeld in Europa aufschließen. Das digitale Estland sollte uns ein Vorbild sein."
Renate und Horst Bottenschein,
Bottenschein Reisen, Ehingen
"Einen positiven Lerneffekt mitnehmen"
 "Bottenschein Reisen hat sich zusammen mit langjährigen Partnern in der Touristik wie auch im ÖPNV einen Namen gemacht. Aus den zwei Standbeinen entstehen neben Vorteilen auch Herausforderungen in dieser turbulenten Zeit: Unsere Touristik-Buchungen sind auf null zurückgegangen, das Reisegeschäft ist zum Erliegen gekommen. Neben der intensiven Kommunikation mit Kunden, Hotelpartnern und Fluggesellschaften zu den gebuchten Reisen sind wir im Linienverkehr vor allem gefordert, die Fahrpläne unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen zum Schutz der Fahrer und Fahrgäste aufrechtzuerhalten. Doch überall macht sich ein trauriges Bild bei uns breit: Dreiviertel unseres Fuhrparks mit rund 70 Fahrzeugen steht abgemeldet in den Bushallen. Aufgrund von Kurzarbeit und Home Office fehlen uns auch unsere Kollegen und besonders der persönliche Austausch miteinander. Dies zwingt uns nun dazu, neue Möglichkeiten zu nutzen – vor allem im digitalen Bereich, beispielsweise mit Video- und Telefonkonferenzen. Doch dies sehen wir als eine Chance, auch zukünftig neue digitale Wege zu gehen und aus dieser Krise einen positiven Lerneffekt mitzunehmen. Im touristischen Bereich planen wir aber bereits für die Zeit nach Corona. Als ersten Schritt werden wir uns auf Ziele im Ländle und der Bundesrepublik konzentrieren. Auch werden bereits jetzt die Weihnachts- und Silvesterreisen geplant. Mit neuem Wissen und erweitertem Horizont sollten wir gestärkt in die Zukunft blicken."
"Bottenschein Reisen hat sich zusammen mit langjährigen Partnern in der Touristik wie auch im ÖPNV einen Namen gemacht. Aus den zwei Standbeinen entstehen neben Vorteilen auch Herausforderungen in dieser turbulenten Zeit: Unsere Touristik-Buchungen sind auf null zurückgegangen, das Reisegeschäft ist zum Erliegen gekommen. Neben der intensiven Kommunikation mit Kunden, Hotelpartnern und Fluggesellschaften zu den gebuchten Reisen sind wir im Linienverkehr vor allem gefordert, die Fahrpläne unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen zum Schutz der Fahrer und Fahrgäste aufrechtzuerhalten. Doch überall macht sich ein trauriges Bild bei uns breit: Dreiviertel unseres Fuhrparks mit rund 70 Fahrzeugen steht abgemeldet in den Bushallen. Aufgrund von Kurzarbeit und Home Office fehlen uns auch unsere Kollegen und besonders der persönliche Austausch miteinander. Dies zwingt uns nun dazu, neue Möglichkeiten zu nutzen – vor allem im digitalen Bereich, beispielsweise mit Video- und Telefonkonferenzen. Doch dies sehen wir als eine Chance, auch zukünftig neue digitale Wege zu gehen und aus dieser Krise einen positiven Lerneffekt mitzunehmen. Im touristischen Bereich planen wir aber bereits für die Zeit nach Corona. Als ersten Schritt werden wir uns auf Ziele im Ländle und der Bundesrepublik konzentrieren. Auch werden bereits jetzt die Weihnachts- und Silvesterreisen geplant. Mit neuem Wissen und erweitertem Horizont sollten wir gestärkt in die Zukunft blicken."
Dieter Hierlemann,
Wirt, Gasthaus/Kleinkunstbühne Adler, Dietmanns
"So viele Zitzen hat keine Kuh"
 Was mir persönlich schon vor der Corona-Epidemie ein großer Dorn im Auge war, besteht in der Tatsache, dass unser Gesundheitssystem wirtschaftlich funktionieren sollte, das heißt, es darf nicht defizitär arbeiten. Das ist blanker Unfug! Wozu dieses auf Erträge ausgerichtete System geführt hat, ist uns nur allzu deutlich vor Augen geführt worden. Zu wenig Intensivbetten, zu wenig Schutzkleidung, überlastete und schlecht bezahlte Pflegekräfte. Da hilft auch ein fettes Dankeschön und eine einmalige Steuererleichterung von 500 Euro perspektivisch nichts. Das muss sich ändern! Des Weiteren hat die aktuelle Krisensituation aufgezeigt, wie demokratiegefährdend die sozialen Medien sein können. An den Haaren herbeigezogene Verschwörungstheorien werden unreflektiert an Unreflektierende weitergeleitet, der klassische Journalismus ignoriert. Ohne jegliche Überprüfung werden von blankem Unsinn und massiver Diskreditierung geprägte 'Informationen' (Fake News) verbreitet.
Was mir persönlich schon vor der Corona-Epidemie ein großer Dorn im Auge war, besteht in der Tatsache, dass unser Gesundheitssystem wirtschaftlich funktionieren sollte, das heißt, es darf nicht defizitär arbeiten. Das ist blanker Unfug! Wozu dieses auf Erträge ausgerichtete System geführt hat, ist uns nur allzu deutlich vor Augen geführt worden. Zu wenig Intensivbetten, zu wenig Schutzkleidung, überlastete und schlecht bezahlte Pflegekräfte. Da hilft auch ein fettes Dankeschön und eine einmalige Steuererleichterung von 500 Euro perspektivisch nichts. Das muss sich ändern! Des Weiteren hat die aktuelle Krisensituation aufgezeigt, wie demokratiegefährdend die sozialen Medien sein können. An den Haaren herbeigezogene Verschwörungstheorien werden unreflektiert an Unreflektierende weitergeleitet, der klassische Journalismus ignoriert. Ohne jegliche Überprüfung werden von blankem Unsinn und massiver Diskreditierung geprägte 'Informationen' (Fake News) verbreitet.
Hinsichtlich der Kulturschaffenden ist die aktuelle Situation natürlich äußerst prekär. Wer von Live-Veranstaltungen mit vielen lebendigen Menschen leben will und muss, hat derzeit so gut wie keine Chance zu überleben. Lösungsvorschlag: die Künstlersozialkasse sollte durch Haushalts-Umschichtungen in die Lage versetzt werden, alle vertraglich fixierten und durch die Pandemie-Verordnungen obsolet gewordenen Auftritte in Höhe der fest verhandelten Auftrittsgagen auszugleichen. Im Bereich der Gastronomie ist die Lage natürlich ebenso verheerend. Verursacht durch mehrere Faktoren war es in den vergangenen Jahren in keinster Weise mehr möglich, Rücklagen zu bilden, sprich mehr zu verdienen als zur Deckung der laufenden Kosten nötig ist. Das hat zur Folge, dass jede noch so kleine Bagatelle den Gastronomen aus seiner finanziellen Umlaufbahn katapultiert. Die jetzige Situation ist allerdings keine Bagatelle mehr, es ist der unvermeidliche Exitus. Dies betrifft im Besonderen die ländliche Gastronomie. Wiederbelebende Vorschläge von meiner Seite: Sofortige Reduzierung der Mehrwertsteuer, ganz deutliche Reduzierung der Umsatzsteuer-Freibeträge durch ehrenamtlich generierte gastronomische Leistungen, Abschaffung der Grundsteuer und so weiter. Denn Solo-Unternehmer wie wir werden permanent gemolken durch Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Grundsteuer, gegebenenfalls Kirchensteuer, Gewerbesteuer, … . Finanzieren müssen wir nötige Versicherungen, Energiekosten, Fahrzeuge, Gehälter, Eigenbedarf, Renovierungen, Altersvorsorge, Krankenversicherung etc. pp. So viele Zitzen hat keine Kuh!
Zu praktischen Beispielen, was bleiben kann/soll: unser Mitnahmeservice wird im Dorf recht gut angenommen. Offenkundig dürfen wir uns einer gewissen Systemrelevanz rühmen. Schön zu beobachten ist auch die Tatsache, dass Bewohner mit pflegebedürftigen Familienmitgliedern/Partnern unseren Service in Anspruch nehmen. In solchen Fällen berechnen wir deutlich reduzierte Preise, ohne es an die große Glocke/Homepage zu hängen. Das könnte man zum Teil beibehalten. Dank an dieser Stelle auch der Dame aus Gutenzell-Hürbel, die uns ihre Vorverkaufskarten für eine ausgefallene Kleinkunst-Veranstaltung zurückgeschickt hat - ohne Rückerstattung. Und, um das zu erwähnen nicht zu vergessen, schon mehrere Essensabholkunden haben sich nach der Print-Ausgabe von BLIX erkundigt, einer sogar ohne Essensbestellung.
PS: Zu Beginn der Krise war auch ich der optimistischen Ansicht, dass die Menschen sich ein wenig besinnen, die Überhitztheit ihres Daseins erkennen mögen und eine dringend anstehende Wertekorrektur vornehmen. Aber so langsam beschleicht mich das Gefühl, dass die Leute es gar nicht mehr erwarten können, wieder ins Hamsterrädchen einzusteigen und es noch schneller zu treten, um Verpasstes wieder aufzuholen. Das geht aber nicht. Manche Dinge sind unwiederbringlich verloren gegangen, Verluste mannigfacher Art nicht mehr ersetzbar. Haben wir durch die Krise wirklich etwas gelernt? Wird sich zeigen. Es bleibt wie immer nur die Hoffnung, und die stirbt bekanntlich immer zuletzt. Oder auch: Optimismus entsteht lediglich aus Mangel an Information. Soweit die Gedanken eines kleinen Dorfgastwirtes in Zeiten von Corona."
Stefanie Bürkle,
Landrätin, CDU, Sigmaringen
"Wir werden als Gesellschaft unsere Prioritäten neu setzen"
 Corona führt bei vielen zu wirtschaftlichen Sorgen und auch den öffentlichen Haushalten in den Städten, Gemeinden und Landkreisen fehlen Einnahmen. Die Rettungspakete des Staates lassen die Verschuldung steigen. Das bedeutet, dass der Staat in den nächsten Jahren vieles nicht mehr in gewohnter Weise wird leisten können. Wir werden als Gesellschaft unsere Prioritäten neu setzen und jeder Einzelne wird für sich und sein Umfeld wieder mehr Eigenverantwortung übernehmen müssen. Ich erlebe in diesen Tagen aber auch einen Zusammenhalt, ein Miteinander, und ein gegenseitiges aufeinander rücksichtnehmen und füreinander sorgen, wie es in normalen Zeiten nur selten zu spüren ist. Menschen leben Verzicht, zeigen Flexibilität, Kreativität, Innovationsgeist und Gemeinsinn. Die Digitalisierung hat einen nie gekannten Schwung erfahren. All dies hoffe und wünsche ich mir, dass wir dies in die Zukunft mitnehmen, und die letzte Zeile des Liedes von Hannes Wader 'dass nichts bleibt, wie es war', als etwas Normales ansehen, das wir annehmen und positiv gestalten.
Corona führt bei vielen zu wirtschaftlichen Sorgen und auch den öffentlichen Haushalten in den Städten, Gemeinden und Landkreisen fehlen Einnahmen. Die Rettungspakete des Staates lassen die Verschuldung steigen. Das bedeutet, dass der Staat in den nächsten Jahren vieles nicht mehr in gewohnter Weise wird leisten können. Wir werden als Gesellschaft unsere Prioritäten neu setzen und jeder Einzelne wird für sich und sein Umfeld wieder mehr Eigenverantwortung übernehmen müssen. Ich erlebe in diesen Tagen aber auch einen Zusammenhalt, ein Miteinander, und ein gegenseitiges aufeinander rücksichtnehmen und füreinander sorgen, wie es in normalen Zeiten nur selten zu spüren ist. Menschen leben Verzicht, zeigen Flexibilität, Kreativität, Innovationsgeist und Gemeinsinn. Die Digitalisierung hat einen nie gekannten Schwung erfahren. All dies hoffe und wünsche ich mir, dass wir dies in die Zukunft mitnehmen, und die letzte Zeile des Liedes von Hannes Wader 'dass nichts bleibt, wie es war', als etwas Normales ansehen, das wir annehmen und positiv gestalten.
Martin Buck,
IHK Präsident Bodensee-Oberschwaben
"Wir brauchen verlässliche Partner in der Politik"
 „Die Erfahrungen der Corona-Krise und ihre weltweiten dramatischen Auswirkungen werden sich tief in unser kollektives Gedächtnis graben. Zweifellos. Wir werden aber erst mit einigem historischen Abstand erkennen können, ob diese Pandemie eine wirkliche Zäsur, ein Epochenbruch und Paradigmenwechsel darstellt – so wie es derzeit in machen Veröffentlichungen beschrieben wird oder ob wir zwar noch lange mit den vor allem wirtschaftlichen Nachwehen zu kämpfen haben, sich dann aber der Mantel der Vergessenheit über Vieles legt.
„Die Erfahrungen der Corona-Krise und ihre weltweiten dramatischen Auswirkungen werden sich tief in unser kollektives Gedächtnis graben. Zweifellos. Wir werden aber erst mit einigem historischen Abstand erkennen können, ob diese Pandemie eine wirkliche Zäsur, ein Epochenbruch und Paradigmenwechsel darstellt – so wie es derzeit in machen Veröffentlichungen beschrieben wird oder ob wir zwar noch lange mit den vor allem wirtschaftlichen Nachwehen zu kämpfen haben, sich dann aber der Mantel der Vergessenheit über Vieles legt.
Eine zentrale Erkenntnis, die wir meines Erachtens aus der Krise aber schon jetzt ziehen können, ist, wie fragil unsere Systeme sind. Sind die global vernetzten Märkte gestört und brechen die weltweiten Transportketten ein, dann geraten die einzelnen Volkswirtschaft in einen Strudel, den sie entweder gar nicht oder nur mit den allergrößten Anstrengungen und unvorstellbar viel Geld gegensteuern können.
Wir stehen vor großen Herausforderungen. In einer Zeit vor Corona galt die Klimakrise als eine der wohl größten unserer Zeit. Das wird in Post-Corona-Zeiten nicht anders sein. Wenn uns die Krise etwas gelehrt hat, dann, dass wir alle unter Umständen flexibler, kompromissbereiter, unbürokratischer und ideenreicher sind als wir uns zu zugetraut haben. Themen wie Home Office, alternative Arbeitszeitmodelle, Videokonferenzen und die damit verbundenen Reduzierung von Geschäftsreisen dürfen wir in dieser Zeit erzwungenermaßen im großen Stil testen. Viele Unternehmen haben hier technisch auf- und umgerüstet und sich umgestellt. Hier sollte man meiner Meinung nach anknüpfen und mutig sein für die Zukunft. So können natürliche Ressourcen geschont und die CO2-Bilanz der Unternehmen verbessert werden. Allerdings werden uns auch unsere Abhängigkeiten, Grenzen und Unzulänglichkeiten aufgezeigt. Ein Beispiel: die zentrale Stellung der Infrastruktur. Menschen ohne stabilen Internetzugang, geringe Übertragungskapazitäten, Funklöcher und das Hinterherhinken beim Glasfaserausbau fallen uns auch im europäischen Vergleich gerade mächtig auf die Füße. Der Ausbau des Stromnetzes für die erneuerbaren Energien, der intelligente Ausbau des ÖPNV, damit die vielen Individualverkehre abnehmen können, die langfristige Sicherung von Lieferketten für systemrelevante Produkte und Technologien sind andere Beispiele. Es gibt viel zu tun. Was wir brauchen, sind verlässliche Partner in der Politik mit dem Wissen um die zentrale Stellung der Wirtschaft bei der Bewältigung aller Krisen und Herausforderungen.“
Marlies Glaser,
Künstlerin, Attenweiler
"Muss ich soviel fliegen, rumfahren, konsumieren?"
 "Ich habe den Eindruck - hoffentlich stimmt er wirklich - dass derzeit doch einige Menschen die Verbindung zum Problem des Klimawandels herstellen und sich überlegen, ihr Leben zu ändern, also sich fragen: Muss ich so viel fliegen, rumfahren, konsumieren? Denn dass die gesellschaftlichen, ökonomischen und individuellen Nöte und Probleme noch um einiges größer würden in Folge des Klimawandels, als in der derzeitigen Pandemie, diese Erkenntnis ist bereits in manchen Kommentaren und Diskussionen zu hören.
"Ich habe den Eindruck - hoffentlich stimmt er wirklich - dass derzeit doch einige Menschen die Verbindung zum Problem des Klimawandels herstellen und sich überlegen, ihr Leben zu ändern, also sich fragen: Muss ich so viel fliegen, rumfahren, konsumieren? Denn dass die gesellschaftlichen, ökonomischen und individuellen Nöte und Probleme noch um einiges größer würden in Folge des Klimawandels, als in der derzeitigen Pandemie, diese Erkenntnis ist bereits in manchen Kommentaren und Diskussionen zu hören.
Für mich wäre es ein wunderbares Ergebnis der Covid-19-Pandemie, wenn viele Menschen nun merken, dass man mit weniger Konsum auch ganz gut leben kann, sogar besser, entspannter - weniger anstrengend. Wenn viele akzeptieren würden, dass, wenn Kleiderschränke voll sind, es keiner weiteren Sachen bedarf, so würden viele Ressourcen eingespart werden.
Zu wünschen wäre, dass sich Medien dazu entschließen, stärker darauf hinzuweisen, dass der drohende und schon begonnene Klimawandel ein viel weniger beherrschbares Problem sein wird. Mich stört, dass, wenn jemand Visionen für eine bessere Welt hat und diese äußert, Forderungen stellt, er mit dem Vorwurf konfrontiert wird, dass man nicht gleich mit ‚erhobenem Zeigefinger‘ kommen soll. Ich frage mich nur, wie kommen Erwachsene zu so einer Wahrnehmung wie aus der Perspektive eines Kindes? Sind sie noch nicht erwachsen und wollen keine Verantwortung, keine Veränderung und keine Mühe?
Gerade in Krisenzeiten lohnen sich Auseinandersetzungen um Perspektiven, um Werte, weil Menschen dafür offener sind. Jetzt sollte sofort damit begonnen werden, eines der großen Umweltprobleme, verursacht durch die weltweite Abholzung der Wälder für Fleischproduktion, diesem ein Ende zu setzen. Zum Beispiel dass die Grünen wieder konsequent auf den Verzicht von Fleischessen pochen, sprich, es versuchen durchzusetzen, denn sie hätten nun viele junge Menschen hinter sich. Endlich Schluss machen mit der ganzen 'Grillkultur-Pest', die leider bald wieder beginnen wird. Sie hätte wohl schon begonnen ohne Corona-Pandemie-Einschränkungen. Auch für eine klimagerechte Landwirtschaft sollten sie sich stärker engagieren. Und noch eines hoffe ich sehr, dass Politiker aus der Krise endlich gelernt haben: autonomer und weniger erpressbar sind wir doch nur, wenn wir mehr auf regionale und nationale Produktion setzen. Dann würde es vielleicht teurer, aber da wir weniger konsumieren, weniger essen (es gäbe weniger Übergewichtige!), wie wir es nun in den letzten Wochen gelernt haben - würde es sich ausgleichen, auch würden viele Transportkosten wegfallen.
Und noch eines zeigte die Krise: Den Einschränkungen und den drückenden Stimmungen etwas entgegengesetzt haben die Künstler. Musiker, Literaten, Bildende Künstler… durch ihre Phantasie. Natürlich bedingt auch aus ökonomischer Not heraus. Trotzdem. Schlussfolgernd sollte die Politik nach dieser Erfahrung eine Betonung auf deren Förderung legen; durch das Verstehen, dass Kunst, Phantasie nicht nur in schweren Zeiten ein Trost sein kann, aber da besonders. Folglich sollte nun die Politik ihr Handeln dahingehend ändern, dass es eine Bejahung größerer Investitionen in die Künste gibt, weil die sich meistens positiv-stärkend auswirken ja, stärkend auf die Demokratie. Und genauso gilt das für alle helfenden Berufe. Sie sollten mehr Wertschätzung erfahren, nicht nur durch Applaus, sondern durch einen Gegenwert, das ist in diesem Fall ihre Bezahlung. Es hört sich so an, als wäre ich dankbar, dass diese Corona-Krise kam. Auf eine bestimmte Weise schon. Denn es ist doch die Mehrheit der Menschen, die nicht nach ihrem Wissen handelt, sondern sich erst zu ändern bereit ist, wenn es wehtut. Nur, treffen tut es leider alle, auch diejenigen, die bisher verantwortungsvoll in ihrem Handeln waren."
Michael Haga,
Mediator, Geco GmbH Süd, Aulendorf
"Raum für grundlegende Veränderungen"
 "Auch in Zeiten des Virus geht es mir gut – finanziell, privat, beruflich. Glückliche Umstände, liebevolle Beziehungen, genug Sicherheit: Ich genieße das Privileg, die Zeit der Isolation in einem kleinstädtischen Idyll verbringen zu dürfen. Doch selbst in dieser komfortablen Situation macht mir Corona Sorge: Die Folgen stellen das Leben der Mehrheit auf den Kopf und bringen für viele große persönliche Not und Vereinsamung. Was mich auch bewegt: Ein kaputtes weltweites System, dessen permanente Steigerung der Gewinne für wenige auf Kosten aller geht, ist zum Stillstand gekommen – und das eröffnet Raum für grundlegende Veränderungen. Dazu gehören gut bezahlte Gesundheitskräfte und auch die Vergesellschaftung und gute Finanzierung zentraler Systeme wie Wasser, Energie, Boden, Gesundheit, Bildung. Aber bietet diese denkwürdige Zeit auch für uns persönlich Chancen für Veränderungen? Davon bin ich überzeugt. In allen Krisen stecken neue Perspektiven. Wir können diese Wochen nutzen, um zu innerer Ruhe zu finden. Um ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch, um bestehende Konflikte zu lösen. Es ist eine Zeit, in der wir die Chance haben, von außen auf uns zu schauen, neue Seiten an uns entdecken, Verantwortung zu übernehmen. Für uns, für unsere Mitmenschen, für unsere Umwelt. Keiner weiß, wohin die Reise geht, welche Richtung die Menschheit einschlägt. Diese Monate werden an uns vorbeiziehen – und dann kommen wieder Zeiten, um neu zusammenzuleben, um zusammenzustehen, um zu streiten und zu feiern."
"Auch in Zeiten des Virus geht es mir gut – finanziell, privat, beruflich. Glückliche Umstände, liebevolle Beziehungen, genug Sicherheit: Ich genieße das Privileg, die Zeit der Isolation in einem kleinstädtischen Idyll verbringen zu dürfen. Doch selbst in dieser komfortablen Situation macht mir Corona Sorge: Die Folgen stellen das Leben der Mehrheit auf den Kopf und bringen für viele große persönliche Not und Vereinsamung. Was mich auch bewegt: Ein kaputtes weltweites System, dessen permanente Steigerung der Gewinne für wenige auf Kosten aller geht, ist zum Stillstand gekommen – und das eröffnet Raum für grundlegende Veränderungen. Dazu gehören gut bezahlte Gesundheitskräfte und auch die Vergesellschaftung und gute Finanzierung zentraler Systeme wie Wasser, Energie, Boden, Gesundheit, Bildung. Aber bietet diese denkwürdige Zeit auch für uns persönlich Chancen für Veränderungen? Davon bin ich überzeugt. In allen Krisen stecken neue Perspektiven. Wir können diese Wochen nutzen, um zu innerer Ruhe zu finden. Um ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch, um bestehende Konflikte zu lösen. Es ist eine Zeit, in der wir die Chance haben, von außen auf uns zu schauen, neue Seiten an uns entdecken, Verantwortung zu übernehmen. Für uns, für unsere Mitmenschen, für unsere Umwelt. Keiner weiß, wohin die Reise geht, welche Richtung die Menschheit einschlägt. Diese Monate werden an uns vorbeiziehen – und dann kommen wieder Zeiten, um neu zusammenzuleben, um zusammenzustehen, um zu streiten und zu feiern."
Dr. Peter Mauritz,
Unternehmenssanierer, Ummendorf
„Weltweite Handelsnetze hilfreich“
 "Warum waren wir auf die Corona-Krise so schlecht vorbereitet, dass wir das öffentliche Leben und die Wirtschaft nahezu vollständig abwürgen mussten? Es gilt die bittere Erkenntnis des sicherlich profiliertesten deutschen Corona-Beraters Prof. Christian Drosten: ‚There ist no glory in prevention!‘. Heißt, in Zeiten in denen die zuständigen Behörden hätten Vorsorge treffen müssen (Intensivkapazitäten, Schutzkleidung), haben diese die Gefahr nicht erkannt bzw. es konnten sich Mahner, die es gab, nicht durchsetzen, so dass Geld in die Hand genommen worden wäre. Also wird man in Zukunft besser zuhören müssen, wenn Wissenschaftler vor Gefahren warnen, auch wenn deren Eintrittswahrscheinlichkeit nur klein ist.
"Warum waren wir auf die Corona-Krise so schlecht vorbereitet, dass wir das öffentliche Leben und die Wirtschaft nahezu vollständig abwürgen mussten? Es gilt die bittere Erkenntnis des sicherlich profiliertesten deutschen Corona-Beraters Prof. Christian Drosten: ‚There ist no glory in prevention!‘. Heißt, in Zeiten in denen die zuständigen Behörden hätten Vorsorge treffen müssen (Intensivkapazitäten, Schutzkleidung), haben diese die Gefahr nicht erkannt bzw. es konnten sich Mahner, die es gab, nicht durchsetzen, so dass Geld in die Hand genommen worden wäre. Also wird man in Zukunft besser zuhören müssen, wenn Wissenschaftler vor Gefahren warnen, auch wenn deren Eintrittswahrscheinlichkeit nur klein ist.
Ist es wegen der Gefahren internationaler Infektions- und Lieferketten ratsam für uns, in Zukunft wieder mehr ‚Nationalökonomie‘ und weniger global zu werden? Eine De-Globalisierung größeren Ausmaßes, auch zur Abwendung der Klimakrise, sehe ich nicht: Dafür sind die Wohlstandsgewinne internationaler Arbeitsteilung zu bedeutsam. Diese kommen auch und gerade sozial Schwächeren weltweit zugute, weil durch sie die Leute in ärmeren Ländern in Lohn und Brot kommen und hierzulande vergleichsweise hohes soziales Leistungsniveau erst ermöglicht wird. Auch sind gerade in Naturkrisen weltweite Handelsnetze hilfreich, über die die Versorgung der deutschen Bevölkerung, aber auch der weltweit betroffenen Hot Spots grundsätzlich gesichert werde kann. In Zukunft werden wir sicherlich eine nationale Grundversorgung nicht nur mit Grundnahrungsmitteln, sondern auch mit wichtigen Geräten und Medikamenten (z.B. wichtigen Antibiotika) sehen.
Und hoffentlich insgesamt noch mehr ‚evidence based politics‘ – faktengestützte Politik."
Mario Trunzer,
Vorsitzender von Südwestmetall Ulm
"Ohne Wirtschaft ist alles nichts"
 "So sehr Abschottung und Shutdowns zur Corona Eindämmung vielleicht richtig waren, so dringend notwendig ist jetzt wieder eine konsequente Rückkehr in eine Normalität unter Schutzbedingungen.
"So sehr Abschottung und Shutdowns zur Corona Eindämmung vielleicht richtig waren, so dringend notwendig ist jetzt wieder eine konsequente Rückkehr in eine Normalität unter Schutzbedingungen.
Sonst besteht die Gefahr, dass Langfristschäden in Wirtschaftsstruktur und Gesellschaft schlimme Nachwirkungen erzeugen. Es steht außer Zweifel: Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts. Und nicht zu vergessen, Steuern werden nun mal durch Beschäftigte und Unternehmen in der Wirtschaft erwirtschaftet.“
Professor Dr. André Bleicher
Rektor Hochschule Biberach
"By desaster, not by design"
 "Die Corona-Krise erweist sich als eine schwerwiegende Wirtschaftskrise und als eine Krise, die nicht auf eine ökonomische Ursache zurückzuführen ist, sondern auf einen exogenen Schock. Das Virus erfordert einschneidende Maßnahmen – es geht um Leben und Tod – die in ökonomischen Kategorien normalerweise nicht fassbar sind. Wir haben es mit gesellschaftlichen und ökonomischen Verschiebungen zu tun. Um welche Prozesse geht es?
"Die Corona-Krise erweist sich als eine schwerwiegende Wirtschaftskrise und als eine Krise, die nicht auf eine ökonomische Ursache zurückzuführen ist, sondern auf einen exogenen Schock. Das Virus erfordert einschneidende Maßnahmen – es geht um Leben und Tod – die in ökonomischen Kategorien normalerweise nicht fassbar sind. Wir haben es mit gesellschaftlichen und ökonomischen Verschiebungen zu tun. Um welche Prozesse geht es?
Das Aussetzen von Produktion und Wertschöpfung aufgrund von Verboten oder mittels politischer Regulation zwecks Eindämmung der Pandemie.
Die Reduktion des Konsums: Ausgehverbote und Ladenschließungen schränken Einkaufszeiten und -volumina ein. Selbst elektronisch getätigte Einkäufe werden aufgrund von Kapazitätsgrenzen zumindest gestört.
Home Office: Unternehmen restrukturieren sich im laufenden Betrieb, der klassische Tagesablauf eines Angestellten / Arbeiters gerät in Unordnung, Management und Organisation müssen sich neuen Gegebenheiten anpassen.
Die Globalisierung – Errungenschaft der letzten 70 Jahre – ist radikal eingebrochen; Unternehmen werden sich, was die Ausgestaltung ihrer Wertschöpfungsketten betrifft, umstellen und versuchen, den Produktionsablauf mit mehr Resilienz zu versehen.
Die Freizeitkultur (Restaurants, Kneipen, Clubs, Events, Sportveranstaltungen etc.) ist stillgelegt, der Feierabend, das Wochenende sind sozial ‚ausgetrocknet‘.
Sämtliche Kulturangebote werden ausgesetzt, die Sendeanstalten greifen auf Konserven zurück, da auch Neuproduktionen nicht mehr möglich erscheinen.
Das Ende des Tourismus steht gleichsam als Menetekel an die Wand geschrieben – Reisen, Flüge, Hotels, Airbnb, all diese Angebote stehen auf absehbare Zeit nicht zur Verfügung.
Autokäufe brechen ein, denn wer sich nicht bewegen kann, denkt nicht über neue Statussymbole nach, die dann in der Garage geparkt werden müssen.
Abstrahiert man von den einzelnen Prozessen, so zeigen sich vier große Tendenzen:
(1) Mobilität bleibt nachhaltig beschränkt und zwar auf allen Ebenen: International werden die Flüge gestrichen und regulieren Einreiseverbote den personellen Austausch zwischen Ländern und Kontinenten. National wird der Reiseverkehr durch Einschränkung der benötigten Infrastrukturen (Hotels) auf ein Minimum reduziert und lokal beschränken funktionale Äquivalente, die gleichsam wie Ausgehverbote wirken, die üblichen Interaktionen. Das öffentliche Leben verschiebt sich aus den realen Räumen in die Virtualität (Social Media und TV).
(2) Gesellschaftlich hat sich eine Halbierung der Arbeit entwickelt, viele Unternehmen, ja Branchen sind vorläufig geschlossen. Neu entdeckt wird die Bedeutung der Daseinsvorsorge: Krankenhäuser, Lebensmittel, Polizei, Feuerwehr und Altenpfleger arbeiten an der Grenze der Belastungsfähigkeit, gleichsam im Dienst an der Gesellschaft.
(3) Das Wachstum – ohnehin schon stagnierend – ist einstweilen beendet, die Ökonomie schrumpft, Szenarien rechnen mit Einbrüchen des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im hohen einstelligen Bereich. Bei einem BIP von 3,44 Billionen Euro in 2019 kann jeder ermessen, was der Verzicht auf nur ein Prozent Wirtschaftsleistung bedeutet.
(4) Die Emissionsbilanzen – im Zuge der Klimakrise ins Bewusstsein gerückt – verändern sich zum Positiven.
Im Grunde schlittert die Welt in einen Zustand hinein, welchen die kapitalismuskritischen Vertreter der Postwachstumstheorie in den Diskussionen der letzten beiden Jahrzehnte als Alternative vorgeschlagen haben: Degrowth, Décroissonce oder Postwachstum ereignet sich ungeplant und vollkommen überraschend, mit einer Vielzahl von Aspekten: Beendigung des globalen Kapitalismus mit seinem aggressiven Wettbewerb, Verschiebungen in der Konsumkultur (weniger kaufen, Grundnahrungsmittel höher bewerten), Eindämmung der globalen Tourismusschwemme, klimatologische Erholung durch Verzicht auf Flüge und Autoverkehr. Aber, wohlgemerkt, dieses Corona-Postwachstum hat seinen Preis, der mit Insolvenzen, Arbeitslosen und mit einem damit einhergehenden sinkenden Wohlfahrtslevel zu entrichten sein wird. Und, Postwachstum ist schlagartig eingetreten, by desaster, not by design, wie sich es die Vertreter des Konzeptes eigentlich wünschen. Postwachstum ist aber im Falle Corona nicht das Ergebnis eines geänderten Bewusstseins, sondern einfach das Ergebnis starker antiepidemischer Maßnahmen. Die Einsicht dafür kommt nicht aus der Reflektion der Wachstumsfolgen, sondern aus der Furcht vor hohen Sterberaten.
Unabhängig davon, ob man den Postwachstumsvorstellungen anhängt oder diese eher skeptisch sieht, die Welt ist unverhofft in ein Großexperiment eingetreten mit der Fragestellung, welche Veränderungen Gesellschaften ertragen können? Veränderungen, die ohne den Virus-Schock nicht denkbar gewesen wären. Zu beantworten bleibt die bedeutsame Frage, was davon post coronam erhalten bleibt? Begrifflich könnte dieses Experiment dergestalt beschrieben werden, dass sich jenseits aller materiellen Maximierung eine ‚Ökonomie der Sorge‘ entfaltet, die das Leben in der Gesellschaft, die Formen des Sozialen, der Geselligkeit, und die Nachfrage nach Gütern aus der Angst vor dem Tod in eine Form extremer Vorsicht presst. Eines steht allen klar vor Augen: Die Gesundheitssysteme müssen erheblich saniert und reorganisiert (aus der Privatisierung erlöst) werden. Des Weiteren wird deutlich: Die Digitalisierung wird einen großen Sprung machen, wenn man bedenkt, dass Institutionen und Unternehmen sich auf home working einstellen, dass Schulen, Behörden und Hochschulen künftig viel stärker digital arbeiten werden. Wie weit das home working, mit seiner relativen Autonomie, die Hierarchien und Organisationen der Unternehmen nachhaltig wandeln wird, bleibt genauso zu beobachten wie die neuen Verknüpfungen globaler Wertschöpfungsketten und ein ganz anderer Umgang mit Rohstoffen.
Ob wir später noch so viel fliegen müssen (weil die digitalen Konferenzen einfacher sind), ob der Tourismus wieder die alten Massendimensionen einnehmen wird, ob wir die Freiheiten, die wir im globalen Verkehr hatten, aufrechterhalten, ob die Finanzmärkte wieder eine dominante Dimension einnehmen dürfen – alles offene Fragen, aber mit Sicherheit werden Spuren der Postwachstumsphase, die wir gerade durchlaufen, erhalten bleiben und eine andere Gesellschaft und Wirtschaft ausbilden. In welchem Maße sich das ereignen wird, ist einstweilen nicht abzusehen. Es wird auch davon abhängen, wie weit der Stress in der Gesellschaft anwachsen wird, inwieweit Insolvenzen und Arbeitslosigkeiten politische Phänomene hervorbringen, über die man eigentlich gar nicht genau nachdenken möchte. Denn Krisenmanagement kann ja auch schiefgehen, weil es selber experimentell und erfahrungslos sein muss.
Zu dieser offenen Situation passt es gut, dass die Hochschule Biberach sich seit geraumer Zeit mit dem Thema Bioökonomie befasst, in dem Sinne, dass an das Konzept zwei Hoffnungen geknüpft sind. Erstens die Hoffnung, dass dieses Konzept es ermöglicht, die globale Ökonomie auf einem moderaten Wachstumspfad zu halten und zweitens, dass Bioökonomie die Option eröffnet gleichzeitig wichtige ökologische Ziele zu erreichen. Kurz gefasst, es geht also darum, den fossil basierten Kapitalismus in einem Transformationsprozess in einen nachhaltig organisierten Kapitalismus zu verwandeln. In diesem Zusammenhang entwickelt die Hochschule – obwohl die krisenbedingte Umstellung der Lehre auf digitale Formate eine erhebliche Konzentration auf diese Aufgabe erfordert – einen Studiengang mit dem Arbeitstitel industrielle Bioökonomie, in enger Kooperation mit der Universität Ulm, und versucht gleichzeitig, das Thema auch in der Bauwirtschaft, einer Kernkompetenz der HBC, zu platzieren. Unter anderem auf dem Wege, dass gegenwärtig wettbewerblich die Finanzierung eines bioökonomischen Forschungsbaus für den Hochschulcampus erkämpft wird. Die Ankündigung der HBC, sich als Transferhochschule zu verstehen, steht vor dem Hintergrund der Corona-Krise vor einer Bewährungsprobe."
Emma Junker
Fridays for future
„Das wünsche ich mir für 2021“
 "2020. Was für ein Jahr! Für die Meisten wohl ein Jahr mit hauptsächlich negativen Erinnerungen. Für mich persönlich als Schülerin, Aktivistin und nicht zuletzt als Jugendliche heißt das natürlich auch Einschränkungen in meiner Freizeitgestaltung und die großen Veränderungen in meinem Bildungsweg durch den Lockdown. Ich sehe aber auch ein Jahr des Wandels, des Umbruchs und des neuen Denkens.
"2020. Was für ein Jahr! Für die Meisten wohl ein Jahr mit hauptsächlich negativen Erinnerungen. Für mich persönlich als Schülerin, Aktivistin und nicht zuletzt als Jugendliche heißt das natürlich auch Einschränkungen in meiner Freizeitgestaltung und die großen Veränderungen in meinem Bildungsweg durch den Lockdown. Ich sehe aber auch ein Jahr des Wandels, des Umbruchs und des neuen Denkens.
In unsere Bewegung FridaysforFuture stecken viele, vor allem junge Menschen gerade große Hoffnungen. Jedoch ist und wird es keine leichte Aufgabe sein, eine Bewegung, die von Aktionen, Gemeinschaft und Präsenz auf der politischen Tagesordnung lebt, in Zeiten, in denen ein Virus oberstes Gesprächsthema ist, aktiv zu halten. Dennoch haben wir auch in schwierigen Zeiten neue, spannende Wege gefunden, weiter aktiv zu bleiben. Beispielsweise durch Social Media. Wir haben Livestreams gestartet, Menschen informiert und kreative Aktionen unternommen. Auch die Klimakommission von Ravensburg hat ihren Abschluss gefunden und wurde einstimmig vom Gemeinderat bestätigt.
Für das kommende Jahr erhoffe ich mir von der Politik vor allem, dass sie anfängt ihr Blickfeld zu erweitern und zu erkennen, dass die Corona-Krise nicht unser einziges Problem ist. Es ist leicht, eine der größten Krisen der Menschheit, den Klimawandel, aus dem Blick zu verlieren, da seine Folgen für uns als privilegierte Deutsche im Moment noch nicht direkt spürbar sind. Denn unfairer Weise werden uns, die Verursacher, die Auswirkungen erst viel später treffen, doch bereits jetzt leiden Menschen, wenn auch für uns nicht sichtbar, darunter.
Ich wünsche mir, dass diese Krise auch endlich als solche behandelt wird und auch Taten zu sehen sind. Denn schnelles und effektives Handeln ist, wie uns diese Zeit gezeigt hat, möglich, sofern man es auch will. Gerade jetzt muss man sich überlegen, ob Regeln wie der eingeschränkte Flug- und Reiseverkehr wirklich alles Einschränkungen sind oder ob man viele dieser Dinge nicht sogar noch weiter ausbauen und beibehalten könnte. Unser Ziel darf jetzt nicht sein, die Pandemie zu überwinden und danach wie bisher weiter zu machen. Unser Ziel muss sein, neue Konzepte zu entwickeln und Altes neu zu denken. Das wünsche ich mir für 2021."
Autor: Roland Reck
